Habitat
Charakteristischer Wohn- oder Standort (auch Fund- oder Sammelplatz) einer Art (oder Gruppe von Arten).
Charakteristischer Wohn- oder Standort (auch Fund- oder Sammelplatz) einer Art (oder Gruppe von Arten).
Nicht intensiv genutztes Landschaftselement (oder Teilbereich davon), das als Habitat für Pflanzen- und Tierarten der Agrarlandschaft geeignet ist.
Siehe Hazienda
Einfache, heute weitgehend in den Tropen verbreitete Form der Bodenbearbeitung mit der Hacke, z.T. auch mit dem Grabstock. Beim Hackbau überwiegen die Knollengewächse. Er wird meist von Frauen betrieben. In Kulturen, die auf Hackbau basieren, findet man häufig matrilineare Erbregeln. Weltweit soll heute noch ein hoher Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen mit Grabstock, Hacke und Spaten arbeiten.
Gruppe von Kulturpflanzen (Knollen- und Wurzelfrüchte), bei denen das Hacken oder eine entsprechende maschinelle Bodenbearbeitung eine wesentliche Kulturmaßnahme zur Erlangung guter Erträge ist (Vermeidung von Verkrustung und Unkrautentwicklung). Heute werden auch Agrarchemikalien zur Unkrautbekämpfung eingesetzt.
Während Kartoffeln, Zuckerrüben und Karotten vorwiegend zum Verkauf (Feldgemüse, Zuckerherstellung) angebaut werden, dienen Massenrüben, Gehaltsrüben, Kohlrüben und Stoppelrüben nur zu Futterzwecken. Zu diesen Futterpflanzen, die vor allem unterirdisch wachsen, können noch Topinambur und der Maniok-Strauch (Tapioka-Strauch) gezählt werden.
Hackfrüchte erfordern höheren Arbeitsaufwand und bringen besonders große Erntemengen: So liefert ein Hektar Futterrüben im Durchschnitt 1.000 dt, ein Hektar Kartoffeln meist über 400 dt; bei Weizen sind es dagegen um 75 dt/ha.
Robuste Getreideart (lat. Avena sativa) aus der Familie der Süßgräser (Poaceae), engl. oats, fr. avoine, deren Körner im Gegensatz zu Weizen, Roggen und Gerste nicht an Ähren, sondern an Rispen wachsen. In den Ährchen befinden sich die Blüten. Das Gras hat eine Wuchshöhe von 0,5 bis 1,5 Meter. Die Grannen, borstenartige Fortsätze an den Deckspelzen, sind nur wenige Millimeter lang.
Hafer wird fast ausschließlich als Sommergetreide angebaut. Auf den Feldern ist die Haferpflanze wegen ihrer Rispenbildung sehr gut von anderen Getreidesorten zu unterscheiden.
Vermutlich stammt der Hafer aus Vorderasien. Da er in Funden aus historischer Zeit immer nur in geringen Mengen auftaucht, geht man davon aus, dass er ein Begleitgras der Gerste und des Weizens war. Als wilde Stammform wird A. fatua oder A. sterilis vermutet. Die Kulturform des Hafers ist vermutlich aus dem auch heute noch vorkommenden Flughafer gezüchtet worden.
Die Belege für einen ersten Anbau von Hafer stammen aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres und sind auf 5.000 v. Chr. datiert. In der Schweiz und nördlich der Donau wurde die Getreideart in der Bronzezeit angebaut. Erst ab dem Mittelalter wurde Hafer auch im Süden Europas genutzt.
Die Haferpflanze bevorzugt gemäßigtes Klima und stellt nur geringe Ansprüche an den Boden. Da er ein gutes Nährstoffaneignungsvermögen besitzt, kommt er auch auf schlechteren Standorten bei ausreichender Wasserversorgung gut zurecht. Feuchtkühle, regenreiche Lagen sagen ihm mehr zu als trocken-heiße. Aufgrund seiner Anspruchslosigkeit und seiner guten Wurzelleistung steht er i.d.R. als abtragende Frucht an letzter Stelle in der FF-Rotation.
Hafer diente zunächst vor allem als Viehfutter, besonders für Pferde. Hafer ist eine wichtige Getreideart für die menschliche Ernährung. Hafer gilt wegen seines hohen Gehaltes an Eiweiß, Lecithin, Vitaminen und Mineralstoffen als eines der nährwertreichsten Getreide. Der Eisengehalt ist ähnlich hoch wie bei Fleisch. Hafer wird in verschiedenen Formen verarbeitet als Hafernährmittel, vor allem als Haferflocken sowie als Futtergetreide für Pferde, Rinder und Geflügel.
Bis zum Mittelalter wurde Hafer als Lebensmittel kultiviert. Obwohl er später als wichtigstes Grundnahrungsmittel durch die Kartoffel abgelöst wurde, blieb Hafer in vielen Gegenden bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiges Nahrungsgetreide. Heute dient das Getreide vorwiegend als Futtermittel.
Hafer wächst in gemäßigten, feuchten Klimaregionen mit hohen Niederschlägen. Anbauregionen sind Nordamerika nördlich des 40. Breitengrades, Nord- und Mitteleuropa und Russland bis zum Ural. In Deutschland wird Hafer hauptsächlich in den Mittelgebirgen, im Alpenvorland und in Küstenregionen angebaut.
Der Anbau von Hafer ist nur auf nicht trockengefährdeten Standorten in geeigneter Fruchtfolgestellung ratsam (nicht Hafer nach Hafer, höchstens 20-25 % Haferanteil).
Führende Anbauländer sind Russland, Kanada, Australien, Polen und die USA. Auf einer Anbaufläche von rund 9,5 Millionen Hektar wurden 2016 weltweit rund 23 Millionen Tonnen Hafer geerntet.
Weitere Informationen:
Bodenwasser, das nicht schwerkraftbedingt versickert, sondern durch Bindungskräfte gegen die Schwerkraft gehalten wird. Es wird gegliedert in das an Oberflächen der festen Bodenpartikel wegen seiner Dipoleigenschaften elektrostatisch gebundene Adsorptionswasser und das mehr im Inneren der Poren befindliche Kapillarwasser. Das Haftwasser ist nur in Fein- und Mittelporen zu finden.
Niederschlag in Form von Eiskugeln oder Eisklumpen mit einem Durchmesser von 5 bis 50 mm. In seltenen Fällen erreichen sie sogar die Größe von Tennisbällen oder Grapefruits, die dann Schäden in Milliardenhöhe an Gebäuden, Fahrzeugen oder landwirtschaftlichen Kulturen verursachen können.
Hochreichende Gewitterwolken (Cumulonimbus) mit starken Auf- und Abwinden erreichen das Hagelstadium, wenn sich unterkühltes Wasser (Flüssigwasser im Temperaturbereich zwischen 0 und −38 °C) und Eiskristalle beim Zusammenstoß vergraupeln und sogenannte Hagelembryos bilden. Bei einem Überangebot von Wassertröpfchen wachsen die Hagelembryos durch mehrfache Auf- und Abbewegungen in der Wolke zu größeren Hagelkörnern durch weitere Anlagerung von Wasser oder Eiskristallen. Nach Erreichen einer bestimmten Größe fallen die Hagelkörner dann aus der Wolke zum Erdboden.
Eingriff in die wolkenphysikalischen Prozesse bei der Hagelbildung. Hagelkörner entstehen in Cumulonimbuswolken, wenn infolge der starken Vertikalbewegungen die Eiskörner in der Wolke mehrfach auf- und abwärtsgerissen werden und dabei mit unterkühlten Wassertropfen zusammenstoßen. Das Wasser lagert sich an die Eiskörner an und vergrößert sie fortwährend. Dies ist durch den schalenförmigen Aufbau der Hagelkörner belegbar.
Bei größeren Eiskörnern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie als Hagelkörner die Erdoberfläche erreichen und dort ganze Getreideareale oder Obstanlagen vernichten. Werden sehr viele kleine Eiskerne in der Wolke erzeugt, so kann sich das unterkühlte Wasser in der Wolke an viele kleine Kerne anlagern, anstatt an wenige große. Bei der kleinen Korngröße ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Ausfallen schmelzen, recht groß, so dass der Niederschlag als Regen auftritt. Als künstliche Eiskerne werden in der Regel Silberjodidkristalle verwendet, da ihre Struktur denen der hexagonalen Eiskristalle sehr ähnlich ist.
Alternativ werden in Obst- und Weinkulturen verstärkt Hagelschutznetze als passive Maßnahmen gegen Hagelschlag installiert.
Der menschengemachte Klimawandel lässt erwarten, dass die bodennahe Luftfeuchte und damit auch die Instabilität der Atmosphäre zunehmen werden, was die Wahrscheinlichkeit von Hagelstürmen erhöht und die Bildung größerer Hagelkörner ermöglicht.
Auch Hagenhufensiedlung; dem Waldhufendorf verwandte, im Hochmittelalter z.B. im Weserbergland, in Schaumburg-Lippe, Mecklenburg und nördlich von Hannover eingeführter gereihter Siedlungstyp.
Eine Hagenhufensiedlung zieht sich entlang einer Straße, die parallel zu einem Bach verläuft, wobei die Straße nur einseitig bebaut wurde, während auf der gegenüberliegenden Straßenseite die zu den Höfen gehörenden handtuchförmigen Ackerflächen von 20 bis 40 Morgen Größe, die Hufe, liegen. Hagenhufensiedlungen sind eine planmäßige Siedlungsform des Hochmittelalters, die aus aneinandergereihten Besitzbreitstreifen besteht. Die Hufe waren so breit wie die Hoflage, und erstreckten sich oft über mehrere 100 Meter.
Der Begriff stammt wahrscheinlich aus dem Hagenrecht, nachdem die Besitzer ein Recht auf Einhegung des zur Nutzung erhaltenen Grunds und Bodens hatten. Noch weiter geht das Hägerrecht, das für die Hägerhufensiedlungen gilt. Hier gibt es einen Hägerjunker und besondere Hägergerichte.
Die eingehagten Grundstücke dienen als Bauerngarten und zur Kleintierhaltung. Der rückwärtig angrenzende Bach liefert das nötige Wasser. Durch diese Art der Siedlung entstanden langgezogene Straßendörfer wie Auhagen, Wiedensahl, Obershagen, Isernhagen, Kathrinhagen oder Rodewald in Niedersachsen. Hagenhufensiedlungen gab es vom Taunus bis nach Vorpommern. Die Gründungen von Hägerhufensiedlungen beschränken sich auf einen Raum im Bereich vom Weserbergland über das Leinebergland bis hin zum Lipperland.
Eine Übertragung erfuhr der Siedlungstyp im Zusammenhang mit der deutschen Ostkolonisation (Mecklenburg, Pommern).
(s. a. ländliche Siedlungsform)
Als Hagenhufenflur wird die landwirtschaftliche Fläche von Hagenhufendörfern bezeichnet. Dabei handelt es sich um einzeilige Reihendörfer oder Einzelhöfe, die mit großem Abstand zueinander an Bächen, in Niederungen, an existierenden historischen Wegeverbindungen oder an sogenannten Ungunststellen, zum Beispiel an Hängen angelegt wurden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung für die Systeme zur Erzeugung von Hähnchenfleisch. Wesentliche Kennzeichen der modernen und intensiven Masthähnchenhaltung sind die ganzjährige Stallhaltung, die Anwendung spezifischer Futtermischungen (Alleinfutter), die veterinärmedizinische Betreuung und Medikamentierung des Futters sowie Impfungen. Ein weiteres Kennzeichen ist die Trennung aller Produktionsstufen (Brüterei, Zuchtlinien-, Eltern-, Vermehrungs- und Endproduktionsbetriebe).
Die Mast von Hähnchen erfolgt in Bodenhaltung auf Einstreu mit ausschließlich unkupierten Tieren, das heißt der Schnabel der Hühner bzw. Hähne wird nicht gekürzt. Bei den Stallformen werden sowohl massive geschlossene Ställe mit Zwangslüftung als auch offene Naturställe mit natürlicher Lüftung genutzt.
Seit dem Jahr 2000 werden Hähnchen in Deutschland auch in Auslauf- oder Freilandhaltung gemästet – entweder in Kombination mit angebautem Außenklimabereich und Auslauffläche oder nur mit einem Grünauslauf. Im Wesentlichen sind derzeit drei Hauptmastverfahren üblich, die durch eine unterschiedliche Mastdauer und entsprechende Mastendgewichte gekennzeichnet sind:

Quelle: Thünen
In den USA mit ihrer weltweit größten Broiler-Industrie sind Offenställe verbreitet, die keinen befestigten Boden haben und deren Seiten nur durch automatisch geregelte Jalousien begrenzt sind. Diese auch „Naturstall“ oder „Lousianastall“ genannte Form hat somit eine freie Lüftung im Gegensatz zum geschlossenen Massivstall mit Zwangslüftung. Die Stallbreite ist dadurch auf 11 Meter begrenzt, die Länge beträgt 80–100 Meter. In diesen Lousianaställen wird vor dem Einstallen der Tiere eine Einstreuschicht in Höhe von circa 35 cm aufgebracht, die nach Mastende nur teilweise entfernt wird (feuchte Einstreu und Staub). Nach ca. einem Jahr (sieben bis acht Durchgängen) kann dann die ganze Schicht entfernt und der Stall nass gereinigt und desinfiziert werden. Die Einstreu bildet eine Mistmatratze, die den Boden erwärmt und hilft, Heizkosten zu sparen. In warmen Sommermonaten wird gekühlt.
Im mitteleuropäischen Klimaraum ist der Boden in der Regel befestigt (Beton), oft in Kombination mit einem geschlossenen und im Winter beheizten Massivstall. Nach 32–38 Tagen erreichen die Hähnchen ein Endgewicht von 1,5–2 kg. Nach dem Ausstallen der Tiere wird der Stall entmistet, mit Hochdruckreinigern gesäubert und anschließend desinfiziert. Als Einstreu dient eine 0,5–1 cm dicke Schicht aus Stroh oder Hobelspänen.
Der Markt für Biogeflügelfleisch ist bislang eine Nische, die nur etwa ein Prozent der gesamten deutschen Geflügelfleischproduktion ausmacht. Die Nachfrage nach Ökogeflügel nimmt jedoch zu: 2016 kauften die Deutschen über zwölf Prozent mehr Biogeflügel als noch im Jahr zuvor. Ökomasthähnchen haben mit 1,3 Millionen Tieren den größten Anteil am ökologischen Mastgeflügel.
Für die Aufzucht und Mast werden im Ökolandbau zwei Verfahren angewendet. Im Ein-Stall-Verfahren werden die Tiere vom ersten Tag bis zum Ausstallen im selben Stall gehalten. Im Zwei-Stall-Verfahren werden die Küken bis zum 28. oder längstens 42. Lebenstag im Aufzuchtstall gehalten und anschließend in den Maststall umgesetzt. Neben der Mast in festen Ställen gibt es noch die Haltung in Mobilställen.
Ökohähnchen haben einen höheren Futterbedarf als konventionelle Tiere. Die Futterverwertung liegt hier bei eins zu 2,4. Zum Vergleich: Im konventionellen Bereich liegt die Futterverwertung bei eins zu 1,67.
Die Organisationsstruktur der deutschen Geflügelwirtschaft weicht nicht von der in anderen EU-Staaten ab. Wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft hat auch in der Mastgeflügelhaltung in den vergangenen Jahren ein starker Strukturwandel stattgefunden. Dies lässt sich am deutlichsten bei der Masthühnerhaltung beobachten: Die Anzahl der Betriebe ging zwischen 1999 und 2016 um rund 28 Prozent zurück, während sich die Gesamtzahl der Masthühner im gleichen Zeitraum um 90 Prozent erhöhte.
Außerdem gab es erhebliche Veränderungen bei den Bestandsgrößen. Die Anzahl Betriebe mit weniger als 10.000 Masthähnchen hat sich zwischen 1999 und 2016 stark reduziert. Deutlich zugenommen haben dagegen die großen Betriebe mit mehr als 50.000 Tieren. Obwohl solch große Betriebe nur einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtbetriebszahl haben, werden dort fast 80 Prozent aller Masthühner gehalten. In Betrieben mit weniger als 10.000 Mastplätzen leben gerade einmal ein Prozent aller Masthühner. Wenige agrarindustrielle Unternehmen bestimmen den Markt (Windhorst 1998).
Die bäuerlichen Hähnchenmäster sind teilweise in Erzeugergemeinschaften zusammengeschlossen, teilweise arbeiten sie auf der Basis von Einzelverträgen. Immer wirtschaften sie jedoch in einem engen Verbund mit Futtermittelwerk, Brüterei, Schlachterei und Zerlegebetrieb.
Der Schwerpunkt der deutschen Hühnermast liegt in Niedersachsen. Dort leben mit 61 Millionen Tieren knapp zwei Drittel aller deutschen Masthühner (2016). Die regionale Konzentration der bodenunabhängigen Geflügelhaltung ist besonders stark ausgeprägt. Im südlichen Weser-Ems-Gebiet wurden 2010 fast 50 Prozent aller Masthühner gemästet (20 Prozent allein im Landkreis Emsland).
Niedersachsen ist auch das Bundesland mit den meisten Betrieben: Über 1.000 Masthähnchenbetriebe gibt es dort. Das Land mit den größten Beständen ist dagegen Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 143.000 Masthähnchen. Die kleinsten Hähnchenmastbetriebe gibt es in Rheinland-Pfalz: Die mittlere Bestandsgröße liegt dort bei 409 Tieren.
In der Alltagssprache werden häufig die Begriffe "Hähnchenmast" oder "Brathähnchen" verwendet. Dies ist nicht ganz treffend, denn gemästet werden sowohl männliche als auch weibliche Tiere. In der Fachwelt werden zur Mast verwendete Hühner als Broiler bezeichnet – abgeleitet von dem englischen Verb "to broil", zu deutsch "braten" oder "grillen".
Bei Broilern handelt es sich zum großen Teil um so genannte Hybride, das heißt Tiere, die aus gezielten Kreuzungen hervorgehen. Im Gegensatz zur Zucht von Legehybriden für die Eierproduktion, für die verständlicherweise nur die weiblichen Tiere genutzt werden können, sind bei den Masthybriden Tiere beiderlei Geschlechts zur Mast geeignet. Männliche wie weibliche Tiere sind nach etwa fünf bis sechs Wochen schlachtreif. In der ökologischen Broilermast dauert es etwa doppelt so lang.
Im Handel dürfen männliche wie weibliche Broiler entsprechend den EU-Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch als "Hähnchen" vermarktet werden.
(s. a. Geflügel, Geflügelhaltung, Tierhaltung)
Weitere Informationen:
Ein Hain ist ein kleiner Wald. Das Wort Hain entstand im 14. Jh. aus mhdt. hagen für „gehegter Wald“, als eine Variante von Hag und gilt in dieser Bedeutung heute als veraltet.
Es wird heute primär im Sinne „Wäldchen, Baumgruppe“ verwendet, also für einen kleinen Wald oder ein Gehölz. Für die Bedeutungsentwicklung und -ausdehnung des Begriffs 'Hain' auf einen „gehegten und gefriedeten Wald, in dem eine Gottheit verehrt wird“ („heiliger Hain“) und auf landwirtschaftliche Flächen („Rebenhain“) waren insbesondere Martin Luther (1483–1546) und später Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) verantwortlich. Außerdem findet sich Hain in der Bedeutung von „Lustwald“ und „Park“, sowie als Wortbestandteil in Fügungen wie Friedenshain und Totenhain, mit denen Waldfriedhöfe gemeint sind. Luther verwendete Hain in seiner Bibelübersetzung ins Deutsche.
In Klopstocks Vorstellungswelt war der Hain Sitz und Symbol der germanischen Dichtkunst. Unter seinem Einfluss begründete Johann Heinrich Voß mit seinen Dichterfreunden in Göttingen 1772 unter dem Namen Hain einen Dichterbund, der 1804 in Hainbund umbenannt wurde. Der „Hain“ wurde dann zu einem allgemeinen literarischen Topos. Goethes Iphigenie auf Tauris von 1786 beginnt mit den Zeilen: "Heraus in eure Schatten, rege Wipfel / Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haines."
Siehe Zweiseitgehöft/-hof
Alte, aber im primitiven Ackerbau (Subtropen / Tropen) noch heute eingesetzte Pflugform mit bloßer Lockerungsfunktion. Nachteilig sind aus acker-pflanzenbaulicher Sicht neben der geringen Flächenleistung die unzureichende Bekämpfung perennierender Unkräuter sowie die meist zu geringe Arbeitstiefe (10 - 15 cm). Andererseits hat der nur oberflächliche Eingriff in den Boden Vorteile in Trockenräumen, in denen die Nährstoffe sich in den oberen Bodenschichten konzentrieren. Gleichzeitig bleiben die unteren Schichten unberührt, wodurch ein Verdunsten der dort gebundenen Feuchtigkeit verhindert wird.
Mit der Entwicklung des Hakenpflugs konnte der Ackerbau stark ausgeweitet werden. Gleichzeitig ging die Bodenbearbeitung in die Hände der Männer über.
(s. a. Bodenbearbeitung, Pflug)
"Halal" ist ein arabisches Wort und bedeutet so viel wie "rein", "erlaubt". Die Speisevorschriften des Islam sind im Koran und in der Sunna geregelt.
Die zulässigen und islam-konformen Speisevorschriften und Lebensmittel sind etwa
Im Gegensatz dazu werden verbotene oder unzulässige Lebensmittel als "Haram"-Lebensmittel bezeichnet. Diese sind typischerweise
Die islamischen Rechtsquellen beschreiben "Halal" und "Haram" sowie weitere Speisevorschriften näher, ohne eine klare Einordnung der "Halal"-Lebensmittel, vorzunehmen. Ob ein Lebensmittel in die "Halal"-Kategorie fällt, ist von verschiedenen Kriterien abhängig, die von islamischen Rechtsgelehrten zum Teil unterschiedlich ausgelegt werden. Es existieren auch keine für alle Muslime gültigen Listen von Lebensmitteln, die ausdrücklich als "Halal" gelten.
In der EU ist der Begriff "Halal" lebensmittelrechtlich nicht geschützt. Für "Halal"-Produkte bestehen bisher keine einheitlichen Standards, die bei einer Zertifizierung überprüft werden. Folglich existieren für Lebensmittel zahlreiche verschiedene "Halal"-Siegel, die von traditionellen oder herstellerorientierten Zertifizierern etabliert wurden.
Das Schächten (betäubungsloses rituelles Schlachten) von Tieren ist in Deutschland grundsätzlich verboten - eine Ausnahmegenehmigung wird nur unter strengen Auflagen erteilt. Halal-Schlachtungen erfolgen hier demnach fast ausschließlich mit Betäubung. Der Import von Fleisch geschächteter Tiere ist erlaubt - bezüglich der Schächtung gibt es keine EU-weit einheitliche Regelung. Fleisch geschächteter Tiere muss nicht entsprechend gekennzeichnet werden.
Mit weltweit über 1,6 Mrd. Muslimen und einer rasch wachsenden Bevölkerung ist die Versorgung mit Fleisch - und speziell mit Halal-Fleisch für strikt praktizierende Gläubige - schwierig, da die Eigenproduktion in den jeweiligen Ländern (z. B. in Nordafrika und im Nahen Osten) aus ökologischen Gründen meist nicht annähernd ausreicht. Da Importe aus nicht-islamischen Ländern (z. B. Schaffleisch aus Australien oder Neuseeland) erfolgen müssen, um den Bedarf zu decken, sind inzwischen eigene Lieferketten zur Bedarfsdeckung entstanden, bei denen die Regeln von Erzeugung, Schlachtung und Verarbeitung, Lagerung, Transport/Logistik bis hin zur Vermarktung durchgängig eingehalten und überwacht werden.
Der Begriff bezeichnet Weideflächen mit kleinflächig einzeln oder in kleinen Gruppen auf der Weidefläche oder zwischen den landwirtschaftlichen Kulturen verteilten Gehölzen, wobei die landwirtschaftliche Nutzung nur zwischen den Gehölzflächen stattfindet. Durch die kontinuierlich Beweidung werden die Weideflächen offen gehalten und eine Verbuschung verhindert.
Halboffene Weidelandschaften zählen zu den ältesten Formen der Landnutzung und sind seit neolithischer Zeit (4000 v. Chr.) bekannt.
In den Anfängen wurde diese Art der Landnutzung in Mitteleuropa in der Regel ohne systematisches Beweidungs- oder Düngermanagement und ohne Vorratshaltung von Viehfutter betrieben. Zu dieser Zeit war der Wald eine wichtige Quelle von Futter und Einstreu und damit auch von Nährstoffen für die landwirtschaftlichen Flächen. Die Übergänge zur Waldweide sind dabei fließend.
Halboffene Weidelandschaften liefern mit ihrer weltweiten Verbreitung Tierprodukte, Brennholz, Beeren, Pilze, Einstreu, Tierfutter

Quelle: Willow / Wikipedia
Ein trockenes, relativ nährstoffarmes Grasland, das im Gegensatz zum Trockenrasen wiesenähnliche, dichte Bestände bildet und zahlreiche relativ breitblättrige, mehr mesomorphe Pflanzen enthält. Entstehen kann er durch Entwaldung und Beweidung bzw. Mahd.
Landschaftstyp, der mit 125 bis 250 mm Jahresniederschlag (Angaben schwankend) geringfügig feuchter als die echte (Trocken-)Wüste ist. Die Halbwüste befindet sich mit einem Pflanzenkleid von weniger als 50 % meist am Rand (in der Übergangszone) einer „Vollwüste“.
Entscheidend für die Differenzierung von Voll- und Halbwüste ist die Verteilung der „Pflanzeninseln“: Während in der Vollwüste nur begünstigte Standorte bewachsen sind, die durch ihre Lage im Schatten oder auf besser wasserspeichernden Böden gekennzeichnet sind, zeigt die Halbwüste ein relativ flächenhaftes Mosaik aus Bewuchs und Lücken, der sich nicht direkt aus den Standortverhältnisse ableiten lässt.
Die Halbwüste leitet zu offenen Vegetationstypen über: den Dornsavannen und Strauchsteppen in den tropisch / subtropischen Trockengebieten (siehe etwa Sahelzone) sowie Trocken- und Wüstensteppen in den trockenen Mittelbreiten, die eine lückige und meist niedrige, jedoch insgesamt über 50 % Pflanzenbedeckung aufweisen. In der Literatur werden Wüstensteppen und Halbwüsten häufig nicht differenziert, obwohl die Vegetationsdecke bei Steppen nach einer häufigen Definition über 50 % liegt; Wüstensteppen jedoch geringer bewachsen sind. Die Klimabedingungen sind sehr ähnlich, jedoch dominieren in den Halbwüsten holzige Pflanzen und in den Wüstensteppen Gräser und/oder Kräuter.
Stärker als in Vollwüsten sind mehrjährige Gräser vertreten. Im Einzugsbereich nomadischer Viehhalter (Alte Welt) bzw. durch Ranch-Systeme (Neue Welt) erfahren Halbwüsten eine anthropogene Ausdehnung gegen die Strauchsteppen.
Die Gesamtheit der Getreidearten zur Unterscheidung von den Blattfrüchten. Halmfrüchte beschatten auf Grund ihrer morphologischen Eigenschaften den Boden nur während einer bestimmten Wachstumsphase in ausreichendem Umfang. Der Boden ist lange dem ungünstigen Einfluss von atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt (Austrocknung oder Verschlämmung). Halmfrüchte fördern nicht die Ertragspotenzen des Bodens. Sie werden deshalb als abtragende Kulturen bezeichnet.
Halophyten sind Pflanzen, die besonders effizient mit hohen Salzkonzentrationen in ihrer Umgebung umgehen können. Dazu zählen vor allem Regionen im Ufer- oder Gezeitenbereich oder Salzwiesen.
Halophyten können die Salzkonzentration in ihrem Gewebe so kontrollieren, dass einerseits keine toxischen Effekte auftreten, andererseits das Gefälle des osmotischen Potenzials steil genug für die Wasser- und Nährstoffaufnahme ist. Sie nehmen wie andere Pflanzen zwar auch die im Boden enthaltenen Salz auf, sind jedoch in der Lage, diese entweder über spezielle Salzdrüsen wieder auszuscheiden oder in speziellen Pflanzenteilen zu deponieren, wo sie photosynthetisch aktive oder salzempfindliche Pflanzenteile und Gewebestrukturen nicht schaden. Dazu zählen zum Beispiel Mangroven, die an der Ober- und Unterseite ihrer Blätter Salzdrüsen besitzen, oder die Quinoa-Pflanze, die das überschüssige Salz in speziellen ballonartigen Blasenzellen an der Blattoberfläche quasi auslagert.
In der Pflanzenforschung spielen Halophyten eine große Rolle, da sie als Vorbild für die Entwicklung neuer Nutzpflanzen mit einer höheren Salztoleranz dienen.
(s. a. Photosynthese, Resistenz)
Kastriertes männliches Schaf, über ein Jahr alt. Eine andere Bezeichnung: 'Schöps'.
Alle diejenigen mineralischen und organischen Düngemittel, die in der Typenliste der Düngeverordnung aufgeführt sind und vom Landwirt gekauft werden müssen.
(s. a. Düngemittel, Dünger, Wirtschaftsdünger)
In der europäischen Agrarstatistik die Bezeichnung für Kulturpflanzen, die normalerweise nicht zum Direktverbrauch verkauft werden, da sie vor der letzten Verwendung industriell verarbeitet werden müssen.
Beispiele: Tabak, Hopfen, Baumwolle, Raps, Rübsen, Sonnenblumen, Soja, Leinsamen, Flachs, Hanf, usw.
Auch Handelsbarriere; jede Einschränkung des internationalen Freihandels im Zuge einer protektionistischen Grundhaltung eines Staates, entweder durch Zölle (tarifäre Handelshemmnisse) oder durch Sanktionen, aber auch durch unterschiedliche Rechts- und Wirtschaftsordnungen. Darüber hinaus kann der freie Warenverkehr aber auch durch indirekte (nicht tarifäre) Handelshemmnisse behindert werden. Hierzu gehören z. B. Ein- und Ausfuhrquoten, Steuervorteile und Finanzförderung inländischer Unternehmen, technische bzw. veterinärrechtliche Vorschriften, Verpackungsvorgaben oder Qualitäts-, Umwelt-, Sozial- und Tierschutzstandards, sowie Herkunftsangaben. Diese wurden und werden vielfach auch zum Außenhandelsschutz gegen die EU genutzt bzw. missbraucht
Die Beseitigung von Zöllen und Mengenbeschränkungen (Kontingente) im Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union war ein wichtiger Schritt zum Europäischen Binnenmarkt. Durch Harmonisierung, Normung und Rechtsangleichung unter den EU-Mitgliedern wurden die bestehenden Handelshemmnisse bis zur Vollendung des Gemeinsamen Marktes Ende 1992 weitgehend beseitigt.
Die Welthandelsorganisation wurde mit dem Ziel gegründet, Handelshemmnisse abzubauen und für alle Mitgliedstaaten verpflichtende Regeln für den internationalen Handel zu schaffen, die auch eingeklagt werden können. Willkürliche Handelsschranken sind verboten. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des Verbrauchers oder zur Verhinderung von Seuchen oder Krankheiten sind aber zulässig.
(s. a. Agrarhandel)
Beispielsweise von der EG definierte Handelsnorm für verschiedene Agrarprodukte, bei der vor allem Transportfähigkeit, Größe und äußere Makellosigkeit bestimmend sind. Ernährungsphysiologische Qualitäten wie Vitamingehalt oder das Fehlen von Rückständen und Zusatzstoffen kommen in diesen Klassifizierungen nicht vor. Der Grund liegt in der Zwischenschaltung von Elementen des Agribusiness zwischen Agrarproduzent und Verbraucher. Einheitliche, normierte Agrarprodukte entsprechen den Bedürfnissen dieses Komplexes nach reibungsloser Weiterverarbeitung und -verwertung (Eignung zur mechanischen Ernte, zum Tiefgefrieren, zum Transport, zur Lagerfähigkeit, zur Dosenkonservierung).
Botanisch gehört Hanf zur Gattung der Cannabisgewächse mit der evtl. einzigen, aus Zentralasien stammenden, heute über alle gemäßigten und subtropischen Regionen der Erde verbreiteten Art Gewöhnlicher Hanf (Cannabis sativa). Die einzelnen Bestandteile der Pflanze (Fasern, Samen, Blätter, Blüten) werden ungenauerweise ebenfalls als Hanf bezeichnet. Aus diesen Pflanzenteilen können jeweils sehr verschiedene Produkte hergestellt werden.
Auch der Indische Hanf (Cannabis indica) ist eine Pflanzenart der Gattung Hanf (Cannabis), wobei umstritten ist, ob der Indische Hanf eine eigene Art oder eine Unterart von Cannabis sativa ist.
Hanf ist ein naher Verwandter des Hopfens (lat. Humulus lupulus) und ähnlich robust wie dieser.
In der öffentlichen Diskussion um Hanf und Cannabis wird unterschieden zwischen THC-armem und THC-reichem Hanf. THC, die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, ist die psychoaktive Substanz der Hanfpflanze, Grundlage für halluzinogene Drogenpräparate wie Haschisch oder Marihuana.
Aus THC-freiem Hanf, auch Faserhanf oder Nutzhanf genannt, lassen sich dagegen keine Rauschmittel gewinnen.
Ursprünglich stammt Cannabis wahrscheinlich aus Kasachstan. Hanf spielte in den Hochkulturen dieser Erde von Beginn an eine entscheidende Rolle als Rohstoffpflanze. Der genaue Zeitraum ihrer Kultivierung ist umstritten. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass sie bereits 4000 Jahre v. Chr. in China angebaut wurde, um aus den Fasern Papier, Textilien, Seile und aus den Samen Öl herzustellen. Das erste nachgewiesene Papier der Welt wurde aus Hanf hergestellt – es blieb ein Stück Hanfpapier aus der Zeit von 140 bis 87 v. Chr. erhalten.
Über Indien und die antiken Hochkulturen im heutigen Irak trat der Hanf seinen Weg um die Welt an. In Europa sind die ältesten Funde ca. 5500 Jahre alt und stammen aus dem Raum Eisenberg (Thüringen).
Im Römischen Reich wurden wegen Hanf Kriege geführt. Hanf war vom ersten Jahrtausend vor Christus bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit die am häufigsten angebaute Nutzpflanze. Im 13. Jahrhundert kam der Papierrohstoff Hanf schließlich nach Europa. Besonders begehrt war die Hanfpflanze aufgrund ihrer heilenden Kraft. Man deckte die Wunden der Krieger mit Cannabisblättern ab, benutzte Hanf gegen Gicht und Geistesabwesenheit. Im Jahr 1455 druckte Gutenberg seine erste Bibel auf Hanf. Als Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, bestanden Segeltuche und das gesamte Tauwerk der Schiffe aus Hanf. Kolumbus brachte den Hanf nach Amerika. Erste Entwürfe der amerikanischen Verfassung und der 1776 unterzeichneten amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurden möglicherweise auf Hanfpapier geschrieben.
Mit der Industrialisierung begann der Niedergang der Hanfnutzung. Damals konnte man Hanf noch nicht maschinell ernten und brechen. Hanfverarbeitung war Handarbeit und daher aufwendig, mühsam und teuer. Rohstoffe wurden entdeckt, die billig eingekauft und rationeller weiterverarbeitet werden konnten. Anfang des 18. Jahrhunderts war die Cotton Gin, erfunden worden, die half, Baumwolle industriell zu verarbeiteten. Die auf diese Weise billig produzierte Baumwolle revolutionierte den Textilmarkt. Daneben wurde die in Indien zu Hungerlöhnen produzierte Jute-Faser nach Europa importiert. Neben der Textilindustrie fand auch die Papierindustrie einen neuen, billigeren Rohstoff: das damals kostenlos verfügbare, massenhafte Holz dichter, weiter Wälder. In Südwestdeutschland ging der Hanfanbau mit dem Aufkommen des für die Bauern rentableren Tabakanbaus sowie mit der Einfuhr von Sisalfasern zurück und kam bis zum Ersten Weltkrieg bis auf wenige Ausnahmen praktisch zum Erliegen.
Als dann 1938 endlich die erste vollautomatische Hanfschälmaschine in den USA vorgestellt wurde, setzten führende amerikanische Industrielle, unter anderem Vertreter aus der Baumwoll- und Pharmaindustrie, eine Hanfsteuer und schließlich ein Hanfanbauverbot in den USA durch und verschlossen damit endgültig die Absatzmärkte für Hanf. In der Mitte des 20. Jahrhunderts verdrängten Kunstfasern besonders des Herstellers DuPont den Hanf auch aus der Bekleidungsherstellung, unterstützt von der Anti-Cannabis-Kampagne von Harry J. Anslinger und und William Randolph Hearst (Zeitungsmogul) ab der dreißiger Jahre. Ausnahmen bildeten hier die „Hemp-for-Victory“-Kampagne des US-Militärs, das dringend den Rohstoff Hanf für die Rüstung brauchte, sowie die Landwirtschaftspolitik im nationalsozialistischen Deutschland, die den Anbau von Hanf als nachwachsenden Rohstoff vor Kriegsbeginn in wenigen Jahren vervierfachte.
Durch die Fortschritte der Pharmaindustrie bei der Herstellung synthetischer Produkte verlor Cannabis im gleichen Zug seine führende Stellung als Medikament. Als allerdings die Rohstoffmärkte im Zweiten Weltkrieg bedroht waren, wurde überall das Hanfverbot zurückgenommen und die Armeen mit strapazierfähiger Hanfbekleidung ausgerüstet. In den USA wurde der Hanfanbau mit dem Film "Hemp for Victory" (Hanf für Sieg) propagiert, der den Farmern vorgespielt wurde. Auch im Deutschen Reich wurde der Hanfanbau zu Kriegszwecken gefördert. "Die lustige Hanffibel" wurde aufgelegt, um für den Hanfanbau zu werben. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Nutzpflanze Hanf endgültig der Garaus gemacht.
In Europa und in Deutschland wurden der Cannabis-Besitz und der Hanf-Anbau im vorigen Jahrhundert in mehreren Schritten gesetzlich verboten. Seit 1996 dürfen jene mehr als 40 Faserhanfsorten wieder legal angebaut werden, deren THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt. Der Anbau ist genehmigungspflichtig. Den Zahlen des zuständigen Bundesamtes für Landwirtschaft und Ernährung haben 2014 insgesamt 100 Betriebe auf mehr als 700 Hektar Hanf angebaut. Weltweit wird die Anbaufläche aktuell auf gut 100.000 Hektar geschätzt.
Hanf ist eine bis 4 m hohe einjährige Pflanze mit Pfahlwurzel. Charakteristisch sind der eckige Stängel und die aus fünf bis neun Fingern bestehenden langgestielten, gesägten Blätter. Hanf ist zweihäusig, d. h. es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die Blüten sind grünlich und unscheinbar. Die einsamigen Früchte sind grauweiße, eiförmige Nüsschen.
Alle oberirdischen Teile der Pflanze (besonders der obere Teil des Stengels, die oberen Blätter und die Deckblätter) sind mit Harzdrüsen und Haaren besetzt. Die 5–55 mm langen Bastfasern des Stengels bestehen hauptsächlich aus Cellulose und werden ähnlich wie Jutefasern (Corchorus) durch Rösten und anschließendes Brechen der nach der Ernte entblätterten und leicht getrockneten Sproßachse gewonnen.
Die schnell wachsenden Hanfpflanzen gedeihen in nahezu allen Regionen der Welt. Die höchsten Erträgt liefern sie in gemäßigtem Klima mit reichlich Wasser.
Am besten gedeiht Hanf auf tiefgründigen nährstoffreichen Böden mit guter Wasserführung. Die Wurzeln des Hanfs können bei entsprechenden Bodenverhältnissen bis zu 140 cm in den Boden eindringen – das ist wesentlich tiefer als bei vergleichbaren Nutzpflanzen. Aus diesem Grund wurde Hanf früher häufig auf ausgelaugten, verhärteten Böden gepflanzt, um den Boden zu lockern und gegebenenfalls für den späteren Anbau anspruchsvollerer Pflanzen wie etwa Getreide vorzubereiten. So hat Nutzhanf einen hohen Vorfruchtwert: Mit seinen tiefreichenden Pfahlwurzeln holt er Wasser aus tiefen Bodenschichten, ist weitestgehend anspruchslos, robust und unterdrückt Beikraut hervorragend. Auch Krankheiten und Schädlinge sind nur selten ein Problem.
Hanf wurde auch in versteppten Gebieten verwendet, um den Boden nicht nur zu lockern, sondern zugleich zu beschatten. Erst wenn der Boden gebessert war, wurden andere Nutzpflanzen gesät.
In Mitteleuropa erfolgt die Aussaat Ende April mit einer angestrebten Saatdichte von 200 Pflanzen pro m². Für die Ernte im August steht derzeit noch keine ausgereifte Technik zur Verfügung. Nach dem Mähen oder Häckseln erfolgen in der Regel eine Trocknung auf dem Feld, eventuell eine Entholzung, das Pressen und die Verarbeitung. Der Gesamtertrag liegt bei 100 - 120 dt/ha mit einem Fasergehalt von 25 - 35 %.
Nutzhanfanbau in Deutschland
Mit einer Fläche von 7.116 Hektar – einem Plus von 1.282 Hektar im Vergleich zum Vorjahr – verzeichnet der Nutzhanfanbau 2024 ein neues Rekordhoch. Damit ist der bisherige Höchstwert aus 2022 um 2,5 Prozent überschritten. Die Anzahl der Betriebe sinkt hingegen auf 623 (- 40 Betriebe im Vergleich zu 2023).
Damit baut jeder der 623 Betriebe durchschnittlich mehr als elf Hektar Nutzhanf in Deutschland an. Die größten Anbauflächen pro Betrieb liegen in Brandenburg (38 Hektar), Sachsen-Anhalt (32 Hektar) und Thüringen (22 Hektar).
Quelle: BLE
Die weltweiten Anbauflächen für Nutzhanf betragen heute etwa 60.000 bis 100.000 Hektar und schwanken stark von Jahr zu Jahr. Für 2005 wurde die weltweite Anbaufläche auf etwa 115.000 Hektar geschätzt, von denen etwa 80.000 Hektar auf Asien (vor allem China und Nordkorea), 14.000 Hektar auf EU-Länder, 5.700 Hektar auf andere europäische Länder, 10.000 Hektar auf Nordamerika (ausschließlich Kanada), 4.300 Hektar auf Südamerika und 250 Hektar auf Australien entfallen. Die führenden Anbauländer sind China, Russland, Kanada und Frankreich, während in anderen Ländern der Anbau eher gering ist. In der Schweiz ist etwa der Kanton Graubünden bekannt für seinen Nutzhanfanbau.
Mit Wirkung zum 16. April 1996 wurde auch in Deutschland nach einer europäischen Verordnung das seit 1982 im Betäubungsmittelgesetz bestehende pauschale Hanfanbauverbot für den Nutzhanf aufgehoben. Seither dürfen zugelassene Nutzhanfsorten wieder angebaut werden, allerdings nur von landwirtschaftlichen Betrieben und auch nur dann, wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) – das ist der in den Blüten enthaltende psychoaktive Wirkstoff – unter 0,2 Prozent liegt.
Obwohl seit 2001 die Europäische Union ihre Subventionen für die Hanfpflanze um rund ein Drittel gekürzt hat, taucht die verdrängte Nutzpflanze allmählich wieder im deutschen Ackerbau auf. Im Jahr 2022 haben in Deutschland 889 landwirtschaftliche Betriebe 6.943 Hektar Nutzhanf angebaut – ein neuer Rekord. Innerhalb von fünf Jahren hat sich damit die Anbaufläche mehr als verdoppelt.
Mit Abstand wichtigstes Anbauland ist Niedersachsen, wo 2022 auf fast 2.000 Hektar Nutzhanf angebaut wurde, gefolgt von Bayern. Auf diese beiden Bundesländer entfallen auch beinahe die Hälfte aller Anbaubetriebe in Deutschland.
Im Jahr 2006 wurden weltweit geschätzt rund 14.400 Tonnen Cannabis erzeugt.
In Europa wurde bis Anfang der 1990er Jahre fast ausschließlich in Frankreich Hanf angebaut (etwa 6.000 Hektar) und zur Produktion von Zigarettenpapier genutzt, geringe Exportmengen kamen aus Spanien nach Frankreich. Vor allem auf der Suche nach Alternativen zum stagnierenden und teilweise rückläufigen Lebensmittelanbau und vor dem Hintergrund zunehmenden landwirtschaftlichen Brachflächen wurde Hanf wie andere nachwachsende Rohstoffe nach dem Wegfall des Anbauverbotes europaweit gefördert, zugleich gewann Hanf als Nutzpflanze zunehmend auch wissenschaftlich und wirtschaftlich Rückhalt.
Hanf ist eine vielseitige Pflanze, da verschiedene Teile vom Stängel bis zur Blüte - zumindest theoretisch - zum "Wohnen und zum Anziehen" verwendet werden können (Lawrence B. Smart, Cornell University). Die Pflanze sei auch eine wertvolle gluten- und sojafreie Proteinquelle, reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die sonst vor allem in Fisch vorkomme. Sie eigne sich daher als Nahrungsergänzungsmittel für Veganer und auch als Tierfutter.
In der Umweltbilanz stehen einem praktisch pestizid- und herbizidfreien Anbau die Anwendung von Fungiziden (bei feuchter Witterung) sowie eine (mäßige) Stickstoffdüngung (auf ehemals ungedüngten Brachflächen) gegenüber.
Aus dem Rohstoff der Hanffasern lassen sich Dämm- und Isolierstoffe gewinnen, Hanf ist Grundlage für zahlreiche Textil- und Papierprodukte. Die Kurzfasern des Hanfes werden wegen ihrer hohen Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Wasserbeständigkeit zu Säcken, Netzen, Seilen, Geotextilien, Dämmvliesen und Autoinnenverkleidungen verarbeitet. Die Zellulosefasern nutzt man zur Herstellung von Spezial-, Filter-, Zigaretten- und Zeitungspapieren. Aus den Schäben lassen sich Baumaterialien, Brenn- und Füllstoffe sowie Einstreu für die landwirtschaftliche Tierhaltung herstellen. Aus den Langfasern schließlich stellt man Bekleidung her.
Im Gegensatz zu aus Holz gewonnenem Papier hat Hanfpapier eine wesentlich höhere Wertig- und Haltbarkeit: Es vergilbt so gut wie gar nicht.
Aus den proteinreichen Hanfsamen lassen sich kosmetische Präparate, aber auch Nahrungsmittel gewinnen.
Als Nebenprodukt der Fasergewinnung fallen die Früchte des Hanfs an. Sie werden als Vogelfutter genutzt oder wegen ihres Fettgehalts (30–35%) zur Ölgewinnung ausgepresst.
Berauschende Cannabis-Produkte wie Marihuana, Haschisch und seltener Haschöl werden von den ausgereiften, getrockneten weiblichen Blütenständen der Hanfpflanze gewonnen und geraucht. Haschisch ist das gepresste Harz, das während der Blüte der Pflanze gewonnen wird. Es wird geraucht oder in Speisen konsumiert. Das aus der Pflanze extrahierte Haschischöl wird entweder gelutscht oder verdampft und eingeatmet. Marihuana wird vor allem für den regionalen Markt produziert, Haschisch dagegen meist über längere Distanzen gehandelt. Der Anbau der Cannabis-Pflanze teilt sich in Outdoor- und Indoor-Plantagen.
Diese Rauschdrogen erzeugen je nach Zustand und Persönlichkeit des Konsumenten Apathie, Euphorie, Halluzinationen oder Erregungszustände. Chronischer Haschischkonsum kann zu psychischer Abhängigkeit und schweren Persönlichkeitsveränderungen auf der Basis hirnorganischer Schäden führen.
Cannabis indica hat eine stärkere sedative Wirkung als Cannabis sativa, das eine mehr psychedelische und anregende Wirkung hat.
Im aktuellen World Drug Report der Vereinten Nationen gibt es keine verlässlichen Daten bezüglich der Herstellung von Cannabis-Produkten. Marihuana wird in praktisch jedem Land produziert und ist somit die am weitesten verbreitete Droge der Welt, auch was den Konsum anbelangt. Oftmals werden die Stoffe auf lokaler Ebene angebaut und dort auch konsumiert. Die Haschisch-Produktion hingegen beschränkt sich auf einige wenige Regionen der Erde, nämlich Nordafrika, den Mittleren Osten und Südwestasien.
Für das Jahr 2017 schätzt UNODC die Zahl der Cannabis-Konsumenten auf 188 Millionen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung für für die immergrüne Vegetation des subtropisch-mediterranen Klimas mit winterlicher Regen- und sommerlicher Trockenzeit. Charakteristisch für die verschiedenen Formen der Hartlaubfomation sind Wälder und/oder Strauchformationen, die je nach Untertyp von Hartlaubgewächsen dominiert werden. Diese Gehölze zeichnen sich durch relativ kleine, steife, ledrige und langlebige Blätter aus.
Die Zone der mediterranen Hartlaubvegetation liegt in den Subtropen, etwa zwischen dem 30. und 40. Breitengrad (auf der Nordhalbkugel auch bis zum 45. Breitengrad). Dabei beschränkt sich das Vorkommen auf die küstennahen Westseiten der Kontinente. Es gibt weltweit fünf voneinander isolierte Regionen der Hartlaubvegetation, in denen sich unabhängig voneinander eine vergleichbare Vegetation entwickelt hat: das Mittelmeergebiet, die Mallee Südwest- und Südostaustraliens, den Chaparral in Kalifornien, Mittelchiles Matorral und den Fynbos in Südafrika.
Polwärts gehen die Hartlaubgebiete häufig in gemäßigte Laubwälder, an den Küsten auch in gemäßigte Regenwälder und Richtung Äquator in heiße Halbwüsten oder Wüsten über.
Die mediterranen Gebiete, die eine sehr hohe Artenvielfalt aufweisen, befinden sich unter großem Nutzungsdruck durch die Bevölkerung. Dies gilt insbesondere und bereits seit der Antike für den Mittelmeerraum. Durch Übernutzung (Holzeinschlag, Beweidung, agrarische Nutzung) und häufige von Menschen verursachte Brände ist die ursprüngliche Waldvegetation zumeist in Degradationsstadien umgewandelt worden (Macchie, Garrigue). Im Extremfall verschwindet die Hartlaubvegetation ganz und wird durch offene Felsheiden ersetzt.
Bezogen auf die potentielle natürliche Vegetation sind heute ca. 2 % der irdischen Landoberfläche Hartlaubgebiete. Die Artenvielfalt (und die darüber hinausgehende Biodiversität) der ursprünglichen Hartlaubvegetation ist hoch bis enorm hoch (3000–5000 Arten pro ha). Insgesamt leben 10 % aller Pflanzenarten der Erde dort.
Nachrichten über ausgedehnte, manchmal sogar Menschen und Siedlungen bedrohende Busch-/Waldbrände in Gebieten des Mittelmeerraums, in Kalifornien, Westaustralien oder in der südafrikanischen Kapregion wiederholen sich mit einiger Sicherheit in jedem Jahr in den dortigen Sommerzeiten. Brände gehören zu den wesentlichen und ebenso ureigenen Merkmalen mediterraner Ökosysteme, auch wenn heutzutage die meisten von ihnen durch Menschen herbeigeführt werden.
Die mediterrane Vegetation ist besonders feuergefährdet, weil Hitze und Trockenheit jahreszeitlich zusammentreffen, die Sträucher und Bäume gewöhnlich dicht stehen und ätherische Öle und Harze das skleromorphe Laub und das Holz leicht entflammbar machen. Die Busch- und Waldbrände sind daher durchweg verheerender als die oftmals nur flüchtigen Grasfeuer in den wintertrockenen tropischen Savannen: Sie zerstören dort, wo sie wüten, nicht selten die gesamte oberirdische Pflanzenmasse.
Dass Waldbrände und Buschfeuer zu den natürlichen Umweltfaktoren mediterraner Gebiete gehören, wird aus zahlreichen Anpassungen der heimischen Pflanzen deutlich. So besitzen viele der Baum- und Straucharten hohe Regenerationsvermögen. Beispielsweise können sie aus dem Stamm austreiben (solange dieser überlebt hat). Bei anderen verbessert sich die Keimfähigkeit ihrer Samen nach Feuerdurchgang (oder wird danach überhaupt erst erreicht).
Viele der Strauchformationen sind daher nicht nur feuerangepasste, sondern auch feuerbedingte (-geprägte) Gesellschaften. Ein Vorteil des Abbrennens liegt darin, dass die in der organischen Substanz gebundenen mineralischen Nährstoffe früher freigesetzt werden, als dies bei einer ausschließlich biologisch-chemischen Zersetzung der organischen Abfälle der Fall wäre. Entsprechend erreicht der Zuwachs an Phytomasse in den ersten Jahren nach dem Abbrennen Spitzenwerte.
Unter dem Strich überwiegen aber eher die Nachteile. So verringert sich mit der Rückstufung der Biomasse letztlich, nach den Anfangsgewinnen, auch die Flächenproduktivität, und auf den abgebrannten Hangflächen kommt es zu einem erheblich verstärkten Abfluss oder/und Tiefenversickerung. Letzteres verstärkt die Bodenerosion und Auswaschung von Nährstoffen und führt unterhalb der Hänge zu einer unvorteilhaften Sedimentation. Eine Landdegradation dieser Art ist gewöhnlich dort besonders fortgeschritten, wo die Feuerfrequenz hoch liegt.
Während die Winterregengebiete Amerikas, Südafrikas und Australiens bis zur Landnahme durch Europäer mit einer ungewöhnlich großen Vielfalt an Nahrungsmittelpflanzen optimale Sammelgebiete für Wildbeuter waren, breiteten sich im Mittelmeerraum seit der Jungsteinzeit Ackerbau und Viehhaltung aus, die das Gesicht der Landschaft nachhaltig veränderten. In den küstennahen Hartlaubregionen etablierten sich Dauerkulturen wie Oliven- und Weinanbau. Die heute prägenden Landschaftsformen der degenerierten Gebüsch- und Strauchheiden Macchie und Garigue sind vorwiegend eine Folge der Beweidung (vor allem mit Ziegen). Zu beiden Vegetationsgesellschaften gehören viele Pflanzenarten, die reich an aromatischen Ölen sind.
Ausgesprochen weit verbreitet sind Bewässerungskulturen. Sie erlauben nicht nur die Nutzung der warmen und strahlungsreichen Sommerzeit, beispielsweise für den Anbau von Gemüsearten, sondern auch den Anbau von wärmebedürftigen und kälteempfindlichen Feldfrüchten wie Reis und Baumwolle. Außerordentlich zonentypisch sind eine Reihe von Sonderkulturen. Dazu zählen die im Mittelmeerraum traditionell wichtigen Rebflächen und Olivenbaumhaine sowie Pflanzungen von Feigen-, Mandel- und Obstbäumen (Pfirsiche, Aprikosen, Agrumenarten wie Orangen und Zitronen). Während sich die Ackerbaugebiete auf die Küstentiefländer konzentrieren, ziehen sich die Baumkulturen auch an den Hängen der Berg- und Gebirgsländer aufwärts, ehe schließlich Naturweiden folgen.
Wo die Pflanzen nicht durch Weinstöcke und Olivenhaine ersetzt worden sind, ist ein niedriges, dichtes Buschwerk, die Macchie, die vorherrschende Vegetationsform am Mittelmeer. Die Macchien wiederum sind vielerorts zur niedrigen Strauchheide, der Garrigue, degradiert.
Die Gemeine Hasel (Corylus avellana), auch Haselstrauch oder Haselnussstrauch genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Birkengewächse (Betulaceae). Sie ist ein meist rund fünf Meter hoch werdender sommergrüner Strauch, der in Europa und Kleinasien heimisch und in Mitteleuropa sehr häufig ist. Bekannt ist sie für ihre essbaren, seit Jahrtausenden vom Menschen genutzten Früchte, die Haselnüsse. Der Großteil der im Handel erhältlichen Haselnüsse stammt jedoch von der nahe verwandten Lambertshasel (Corylus maxima). Das Art-Epitheton avellana bezieht sich auf die antike italienische Stadt Abella, heute Avella, in der heutigen Provinz Avellino in Kampanien nahe dem Vesuv. Die Region ist für ihren Haselnussanbau schon seit dem Altertum bekannt.
Einfirsthof auf der Halbinsel Eiderstedt mit Steildach, 1 - 2 Gulfen, Wohnteil in voller Breite des Wirtschaftsteils und einer nicht durchfahrbaren Diele.
Historische Form der kombinierten Forst-/Landwirtschaft. Vor allem in Gebirgslagen mit Mangel an brauchbarem Ackerland wurden Niederwälder zeitweilig in die landwirtschaftliche Nutzung einbezogen. Im Eichenniederwaldbetrieb zur Gewinnung von Gerberlohe wurde Getreide (im 19. Jh. meist Roggen, früher Buchweizen) zwischen den Eichenstöcken angebaut, solange die Bestandesdichte noch locker war. Das geschlagene Holz wurde über die Köhlerei vor allem zur Verhüttung von Erzen und ebenso wie der Lohkuchen (in Formen gepresste ausgelaugte Lohrinde) zum Hausbrand genutzt. Die eingeschlagenen Flächen wurden in Brand gesetzt, um für die nachfolgende Getreidekultur einen Düngungseffekt (P und K) zu erzielen. Ab dem 5. Jahr des Stockausschlags wurde eine etwa 1 - 3-jährige Periode des Weidegangs eingeschaltet. Die Haubergwirtschaft war im Rheinischen Schiefergebirge, besonders im Siegerland, verbreitet und dort wegen ihres klugen Umgangs mit knappen Ressourcen jahrhundertelang Garant wirtschaftlicher Sicherheit. Dort wurden diese Wald-Feld-Systeme erst im Laufe des 20. Jh. aufgegeben.
(s. a. Feldwaldwirtschaft, Reutbergwirtschaft, Schiffelwirtschaft)
Weitere Informationen:
Bezeichnung für eine landwirtschaftlich angebaute Frucht (z.B. Kartoffel, Spargel), zu deren optimaler Entwicklung die Erstellung von Erddämmen erforderlich ist.
Herstellen von Erddämmen, vor allem im Kartoffelanbau. Diese Dämme, in denen dann die Pflanzen wachsen, dienen dazu, einen günstigen Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt im Boden zu schaffen und die Standfestigkeit zu erhöhen. Außerdem erleichtern sie die Ernte, verhüten Schäden, die durch Freiliegen der Kartoffel entstehen und dienen auch der Unkrautbekämpfung. Das Häufeln muss zur Unkrautbekämpfung vor allem beim Verzicht auf Herbizide (Ökolandbau) wiederholt werden.
Gerade bei Kartoffeln ist das Häufeln auch für den Ertrag wichtig. Kartoffeln, die nicht gehäufelt werden, haben zudem oft im Spätsommer das Problem, dass die frischen Knollen den Damm durchstoßen und das Tageslicht erblicken. An diesen Stellen bilden sie dann Solanin aus und werden grün. Das Solanin ist für uns Menschen giftig, grüne Stellen müssen also komplett vor dem Kochen entfernt werden.
Auch Haufensiedlung, teilweise auch geschlossenes Dorf als Synonym; es ist der bekannteste Typ flächiger oder geschlossener Wohnplätze mit komplexem, nicht notwendigerweise regellosem Grundriss. Zumindest in Ortsteilen weisen auch Haufendörfer regelhafte Strukturen auf, z.B. bei der Ausrichtung von Hofstätten auf Parzellen mit besonderen Funktionen (Wehrkirchhof). Als geschlossener Rechtsbezirk war der Dorfraum oft mit Zäunen bzw. dem Dorfetter gegen die Flur abgegrenzt.
Geschlossene Dörfer entstanden sowohl in primärer Anlage, als auch durch sekundäre Vorgänge der Verdichtung und des Wachstums. Sehr dichte und große Haufendörfer finden sich in den Realteilungsgebieten Mittel- und Südhessens oder Württembergs.
(s. a. ländliche Siedlungsform)
Hofform, bei der eine Trennung der Gebäude nach Funktionen und eine unregelmäßige Anordnung vorliegt. Der Haufenhof ist in den Alpenländern und in Skandinavien verbreitet.
Ab der Agrarstrukturerhebung / Landwirtschaftszählung 2010 sind Haupterwerbsbetriebe solche, in denen das Einkommen des Betriebsinhabers (und ggf. seines Ehegatten) aus betrieblichen Quellen höher ist als das Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen. Das Gegenstück ist der Nebenerwerbsbetrieb. Die Typisierung in Haupt- und Nebenerwerb erfolgt nur für Betriebe in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Nebenerwerbsbetriebesind demnach alle anderen Betriebe.
Bis 2007 spielte neben der Relation von betrieblichen und außerbetrieblichen Einkommen die Arbeitsleistung (ausgedrückt in Arbeitskraft-Einheiten) je Betrieb eine Rolle.
Danach galten als Haupterwerbsbetriebe solche Betriebe, in denen
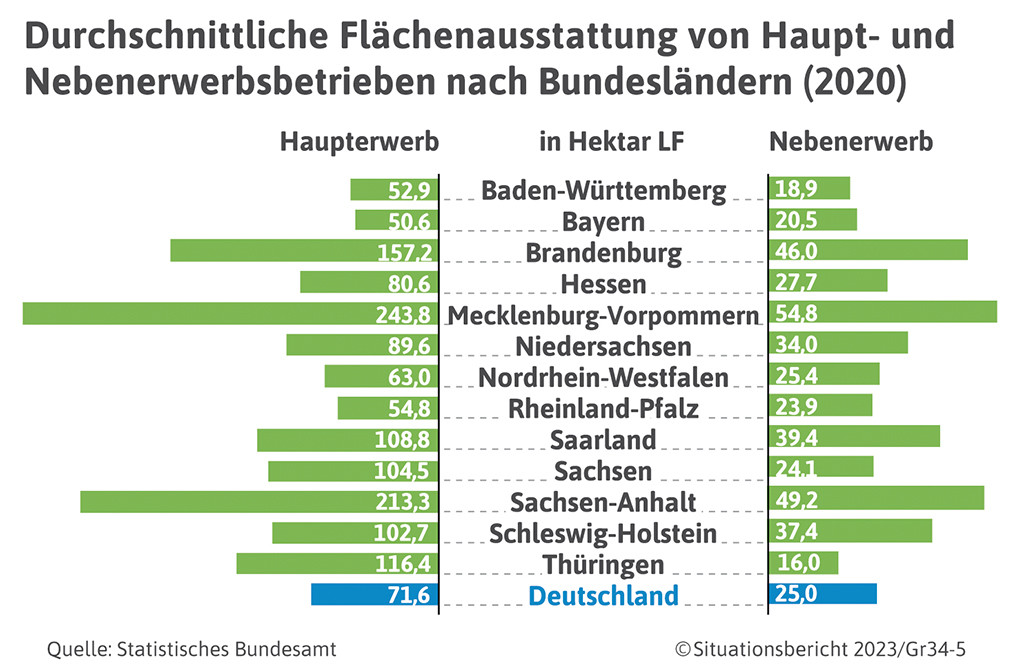
Quelle: Situationsbericht 2023
Bei mehreren auf der gleichen Fläche während des gleichen Vegetationszeitraums angebauten Folgekulturen jene Kultur mit dem höchsten Produktionswert. Sind die Produktionswerte annähernd gleich, so wird die Kultur, die den Boden am längsten beansprucht, als Hauptkultur betrachtet.
Der Hausgarten ist der unmittelbar zu einem bewohnten Gebäude gehörende Garten, der zur privaten Erholung und zum Anbau von Nutz- und Zierpflanzen genutzt wird.
Die Regelungen für Hausgärten variieren, abhängig von den Zielen und der konkreten Nutzung. Im Allgemeinen sind dabei Baugesetze, Nachbarschaftsgesetze, Pflanzenschutzgesetze und ggf. kleingartenrechtliche Bestimmungen von Bedeutung.
Sammelbezeichnung für die aus dem süostasiatischen Bankivahuhns (Gallus gallus) gezüchteten Hühnerrassen. Früheste Hinweise auf eine Domestikation stammen von Tonfiguren und Gefäßmalereien der Kulturen des Industales aus der Zeit um 2500 v.Chr. Im 15. Jahrhundert v.Chr. war das Haushuhn in China und Ägypten bekannt, nach Europa kam es im 6. Jahrhundert v.Chr. Mit den Römern fand das Haushuhn eine größere Verbreitung in Europa. Sie begannen die Hühner im großen Stil als Eier- und Fleischlieferanten zu züchten.
Das Haushuhn gehört zur Familie der Fasanenartigen (Phasianidae). Landwirtschaftlich zählt es zum Geflügel. Das männliche Haushuhn nennt man Hahn oder Gockel, den kastrierten Hahn Kapaun. Das Weibchen heißt Henne, Jungtiere führende Hennen Glucke. Die Jungtiere heißen allgemein Küken.
Auf Grund der langen Domestikationsgeschichte sind eine große Vielzahl unterschiedlicher Hühnerrassen entstanden. Allein im europäischen Rassegeflügelstandard werden über 180 Rassen und Farbenschläge unterschieden. In der industriellen Landwirtschaft kommen Hybridhühner zum Einsatz, welche sich nicht zur Weiterzucht eignen. Mast- und Legehybride werden von weltweit nur vier Konzernen gezüchtet und vermarktet.
Die meist weißen Eier (Hühnerei) werden von der Henne 20–21 Tage lang bebrütet; sie allein führt und hudert (Hudern) die nestflüchtenden Jungen. Die Wirtschaftsgeflügelzucht verwendet zur Erzeugung von Eiern und Fleisch überwiegend Hybrid-Zuchten mit durchschnittlichen Legeleistungen von 250–300 Eiern pro Jahr. Eine so hohe Legeleistung ist durch die regelmäßige Wegnahme der abgelegten Eier möglich, so dass nie ein vollständiges Gelege erreicht wird, was normalerweise die Eiablage stoppt. Die Nahrungsansprüche des Haushuhns als bestuntersuchtem Haustier sind so detailliert bekannt, dass weitgehend automatisierte Geflügelfarmen möglich sind (Batteriehaltung, Massentierhaltung).
Die Hühnerhaltung ist Bestandteil der Geflügelproduktion in Agrarbetrieben und umfasst die drei Betriebsarten Eierproduktion, Broilermast und Aufzucht.
Landwirtschaftliche Betriebe, die sich auf die Produktion von Eiern fokussieren, halten Legehennen etwa zwei Produktionszyklen in Volierensystemen, der Bodenhaltung oder auf Kotgruben, bevor die Tiere als Suppenhühner verkauft werden.
Währenddessen liegt die Zielsetzung bei der Broilermast auf einer möglichst hohen Gewichtszunahme in kurzer Zeit, die die Betriebe mithilfe von kalorienreichem Futter anstreben.
In Aufzuchtbetrieben werden speziell Küken gehalten, die im Anschluss an die Mastbetriebe weiterverkauft werden. Aufgrund der Unterbringung vieler Tiere auf kleinem Raum kommt es in der Bodenhaltung von Hühnern oftmals zu einem erhöhten Krankheitsrisiko, das viele Betriebe durch umfangreiche Präventionsmaßnahmen wie Sanitärtechnik, Isolation oder Impfungen und eine Dauer-Medikation zu senken versuchen. Der Großteil der anfallenden Kosten fällt in der Hühnerhaltung allerdings vor allem auf den Erwerb von Futtermitteln, die im Betrieb zubereitet werden oder bereits fertig gemischt gekauft werden können. Neben Kohlenhydraten, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen wird in der Hühnerhaltung oftmals auch das so genannte Geflügelgrit (granulates Futtermittel aus kleinen Steinen und Kalk) zugefüttert, das ein Zerkleinern der Nahrung im Magen der Tiere erleichtern soll. Nach Informationen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz werden in Deutschland inzwischen 63 % der Legehennen in Bodenhaltung auf durchschnittlich 0,11 qm Stallfläche gehalten. Auch bei der Geflügelmast nimmt die Freilandhaltung oder ökologische Haltung laut BMEL nur einen kleinen Anteil ein. Die konventionelle Käfighaltung, in der Hennen auf engstem Raum vorwiegend in Legebatterien gehalten werden, wurde in der Vergangenheit vor allem von Tierschützern kritisiert und ist seit 2012 in der gesamten EU verboten.
Das Haushuhn gilt als das häufigste Haustier des Menschen – der durchschnittliche tägliche Weltbestand wird auf mehr als 20 Milliarden Tiere geschätzt. Die Zahl der jährlich geschlachteten Haushühner liegt deutlich über dem durchschnittlichen Bestand und wird auf 45 Milliarden geschätzt. Das wird darauf zurückgeführt, dass Hühner heute in nur wenigen Wochen ihr Schlachtgewicht erreichen.
Weitere Informationen:
Vor allem in SW-Deutschland üblicher Begriff für einen bäuerlichen Kleinstellenbesitzer.
Das Hausschaf (Ovis gmelini aries), kurz auch Schaf, ist die domestizierte Form des Mufflons. Es spielt in der Geschichte der Menschheit eine bedeutende Rolle als Milch-, Lammfleisch- beziehungsweise Hammelfleisch-, Woll- und Schaffelllieferant.
Auf der Welt gab es 2018 1,2 Mrd. Schafe, wovon ca. 50 Prozent in Asien lebten. In Afrika waren etwa 30 Prozent beheimatet und in Europa ungefähr 10 Prozent. Der Rest verteilte sich auf Ozeanien und Amerika.
In Europa lebten in Großbritannien mit zirka 33 Mio. Tieren im Jahre 2018 die meisten Schafe. Im Vergleich spielte Deutschland mit 1,6 Mio. Tieren 2018 eine geringere Rolle. Die Schafbestände in der EU sinken in den letzten Jahren stetig, was auf die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und die Entkopplung der Prämien von der Produktion zurückgeführt wird.
Betrachtet man die beiden wichtigsten Produktionsrichtungen, Fleisch und Wolle, fällt auf, dass Asien vor allem Wolle erzeugt und Europa Fleisch. Neuseeland nimmt hinsichtlich der Produktivität sowohl beim Fleisch als auch bei der Wolle eine Spitzenstellung ein. Afrika hat eine geringe Produktivität; dort werden aber vermehrt Rassen gehalten, die für die Haar- bzw. Pelzproduktion gezüchtet wurden.
In Deutschland überwiegt die standortgebundene Schafhaltung. 1994 wurden über 34 Prozent des Bestandes auf gehalten. Die Herden, die das Bild in der Öffentlichkeit prägen, die Wanderherden und die Deichschäferei hatten 1994 einen Anteil von 15,7 bzw. 4 Prozent.
Die Schafhaltung stellte in vielen Kulturen, besonders im Mittelmeerbereich, eine häufige Form der Landwirtschaft dar. Das Schaf hatte eine fundamentale Bedeutung in den alten Wirtschaftssystemen und diente lebend als Lieferant für Wolle und Milch, mit Milchprodukten wie Joghurt, Kefir und Schafkäse, sowie das geschlachtete Tier als Fleisch- und Fell-Lieferant. Schafe liefern beispielsweise auch das Rohmaterial für Leime, Kerzen und Seife (Talg) und kosmetische Produkte, der Darm wird bei der Wurstherstellung und zum Bespannen von Tennisschlägern verwendet, der Schafskot liefert hochwertigen Dünger.
In Europa werden überwiegend intensiv genutzte Rassen gehalten, die der Fleischerzeugung dienen. Die Lämmermast ist damit der wichtigste Zweig der Schafhaltung. Das war nicht immer so: Schafe wurden in Deutschland bis Anfang der 1950er Jahre vor allem auf den Wollertrag gezüchtet. Durch die Verdrängung der Schafwolle durch Baumwolle und chemische Fasern ist seitdem ein starkes Umschwenken der Zuchtrichtung festzustellen. Galt bis dahin, dass die Wolle etwa 90 Prozent und die Lämmer etwa zehn Prozent des wirtschaftlichen Ertrags liefern, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt. Erhielt man 1950 für ein Kilogramm Wolle noch 4,50 DM (2,30 €), so liegt der Preis heutzutage – unter Schwankungen – bei 0,50 bis 0,75 € pro Kilogramm. Neben der Züchtung auf Wolle gibt es noch die Züchtung auf Milchleistung wie zum Beispiel beim Ostfriesischen Milchschaf oder auf das Fell (Lämmer des Karakulschafes) und Fleisch.
In Deutschland werden die extensiven Schafrassen zur Landschaftspflege eingesetzt. Sie erhält Grünflächen oder Landschaftsformen wie die Heide in ihrer Form und Funktion. Ohne die Schafe würden diese Landschaften versteppen bzw. verwalden. Eine besondere Funktion besitzen Schafe beim Schutz von Deichen. Nicht nur verhindern sie eine Versteppung, durch ihren Tritt festigen sie den Untergrund und leisten einen direkten Beitrag gegen einen möglichen Deichbruch. Für diese Ökosystemleistungen werden Schäfer oft über Fördermittel des Naturschutzes vergütet, der Erlös der Schafsprodukte tritt dann in den Hintergrund.
Das Hausschwein (lat. Sus scrofa domesticus) ist die domestizierte (in menschliche Haltung genommene) Form des Wildschweins und bildet mit ihm eine einzige Art. Es gehört damit zur Familie der Echten Schweine aus der Ordnung der Paarhufer. In einigen Teilen der Welt gibt es freilebende Schweinepopulationen, die aus verwilderten Hausschweinen hervorgingen. Schweine sind Allesfresser; sie fressen sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung.
Das Hausschwein ist eines der am frühesten domestizierten Haustiere in der menschlichen Zivilisationsgeschichte und wird seit vermutlich 9000 Jahren zur Fleischerzeugung gehalten. In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch die am häufigsten gegessene Fleischsorte. Die Domestizierung erfolgte in unterschiedlichen Weltregionen unabhängig voneinander.
Weitere Informationen:
Zu dt. Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte; Qualitätswerkzeug, das für Produktion von und Umgang mit Lebensmitteln konzipiert wurde. Es ist klar strukturiert und auf präventive Maßnahmen ausgerichtet. Das Konzept dient der Vermeidung von Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmitteln, die zu einer Erkrankung oder Verletzung von Konsumenten führen können.
Das HACCP-Konzept wird als Instrument benutzt, um die kritischen Punkte eines Prozesses und damit die Festlegung bestimmter Kontrollen in der Lebens- und Futtermittelbranche zu ermitteln sowie deren Einhaltung zu dokumentieren. HACCP wird im Codex Alimentarius definiert und gilt mittlerweile als weltweit akzeptiertes Konzept zur Risikobeherrschung, das sowohl in staatlichen Kontroll- als auch privatwirtschaftlichen Zertifizierungssystemen vorausgesetzt wird.
Landwirtschaftlicher Großbetrieb (span. hacienda) in von früherer spanischer Kolonialherrschaft beeinflussten Gebieten. Ihre volle Entfaltung erlangte die Hazienda im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Hazienda-Wirtschaft war ein System zur Sicherung des Monopols am Boden und der zu seiner Bewirtschaftung erforderlichen Arbeitskräfte. Sie diente vornehmlich dem sozialen Ansehen der Besitzer, dem hacendado, während das Produktionsmotiv und die Absicht, materielle Gewinne zu erwirtschaften, zweitrangig war. Lediglich lokale Märkte wurden beliefert. Die Produktionsziele waren regional recht unterschiedlich, wobei es sich häufig um Betriebe mit Viehhaltung, aber auch um solche mit Ackerbau oder Dauerkulturen handelte. Die Arbeitskräfte erhielten eine kleine Parzelle zur Subsistenzwirtschaft. Sie waren verpflichtet, als Gegenleistung drei bis fünf Tage in der Woche für den Grundherrn zu arbeiten, der sich selbst die besten Böden vorbehielt.
Die Größe einer Hazienda variierte regional stark, konnte aber eine Fläche von mehreren tausend Hektar umfassen. Ein Teil des Grundbesitzes wurde oft verpachtet, andere Stücke wurden der Brache überlassen. Im Regelfall war der Besitzer stadtsässig und übertrug die Betriebsführung einem Verwalter, blieb aber zusammen mit seiner Familie zentrale Autorität (Absentismus). Die Besitzer waren fast ausschließlich Spanier und Kreolen und in selten Fällen Mischlinge.
Der Begriff Hazienda ist ungenau, bezieht sich aber gewöhnlich auf Landgüter von beträchtlicher Größe. Kleinere Besitztümer wurden estancia (Estanzia) oder rancho genannt. Der traditionelle Typus der Hacienda war vor allem in Mexiko und Bolivien vor den Revolutionen anzutreffen, ebenso in Chile und Peru vor 1970. Heute ist er nur noch vereinzelt in besonders wenig entwickelten Gebieten (z.B. in Kolumbien und Ecuador) vorhanden. Die brasilianische Entsprechung der Hacienda ist die Fazenda.
Neben der Landbewirtschaftung gab es auch Haziendas mit Bergwerken oder Fabriken. Viele Haziendas kombinierten diese Produktionszweige.
In den letzten Jahrzehnten benutzt man den Begriff in den USA zur Kennzeichnung eines Architekturstils im Zusammenhang mit den früheren Herrenhäusern.
Das Haziendasystem mit seinem großen Landbesitz bestand in Argentinien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Neugranada und Peru. Ein ähnliches System bestand in kleinerem Umfang in Puerto Rico und auf den Philippinen. In dem Archipelstaat hat eine mächtige Klasse von Großgrundbesitzern (Kaziken) bis heute eine dominante Position in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wenngleich seit 1972 Reformen initiiert wurden, um die extreme Landkonzentration sowie die damit verbundene Ausbeutung der Landbevölkerung zu mildern und so die Gefahr revolutionärer Bauernaufstände zu unterbinden.
Durch die Konquista fiel im 16. Jahrhundert ein Großteil des Landes in Mittel- und Südamerika an die kastilische und portugiesische Krone, die wiederum die Konquistadoren zeitlich beschränkt mit den Tributen (encomienda) indigener Gemeinden belohnten. Zusätzlich wurde im Folgenden durch Schenkungen, illegale Besetzungen und dubiose Geschäfte immer mehr Land an Konquistadoren und Siedler verteilt. Dies wurde durch den drastischen Rückgang der indigenen Bevölkerung im 16. und 17. Jahrhundert begünstigt und gerade encomenderos gründeten daraufhin häufig Haziendas. Durch die Enteignung und Privatisierung kirchlicher Güter vergrößerte sich der Großgrundbesitz in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein weiteres Mal. Auch durch technologische Entwicklungen, sowohl durch bessere Marktanbindung als auch durch bessere Produktionstechnologien, wurde die Expansion erleichtert.
Strukturelle Eigenschaften waren die Beherrschung der Märkte, der Böden und Wasservorkommen und der Arbeitskräfte durch die Hazienda und ihre Eigentümer in ihrer Umgebung, wobei andere Merkmale wie die hauptsächlich produzierten Produkte oder die Betriebsorganisation variierten. Während ihre Form vom 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts stabil blieb, näherte sie sich dann wegen besserer Anbindung an die (überregionalen) Märkte der Plantage an. Diese, sowie die Viehzucht-Haziendas im heutigen Argentinien und Uruguay, waren exportorientiert und größtenteils in den Regionen der Atlantikküsten Amerikas gelegen. Die Hochland-Haziendas produzierten Getreide und Vieh für nahegelegene Bergwerkszentren und spanische Kolonialstädte. Aufgrund der hohen Transportkosten in den gebirgigen Gegenden Amerikas blieben sie auf regionale Märkte beschränkt, eine Ausnahme war z. B. der Wollexport nach Europa ab den 1830er Jahren.
Lange war die Hazienda ein relativ abgeschlossenes soziales System, deren Bewohner nur sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hatten. Viele Eigentümer der Haziendas zählten aufgrund ihrer Einkünfte zu den regionalen und nationalen Eliten.
(s. a. Estancia, Latifundium, Plantage)
Hecken als Elemente der Flur setzen sich aus verschiedenen Bäumen und Sträuchern und ergänzend aus ein- und mehrjährigen krautigen Pflanzen und Gräsern zusammen. Sie verlaufen mehr oder weniger durchgehend und linienförmig (gebüschreiche Gehölzstreifen). In der Regel besitzen sie am Boden eine Breite zwischen 2 und 15 Metern.
In "Strauchhecken" bestimmen strauchförmig wachsende Holzgewächse die Silhouette der Hecke. Häufig sind darin Holunder, Hasel und Hainbuche aber auch Dornensträucher wie Weißdorn, Schlehen, Brombeere, Himbeere und Wildrosen. Voraussetzung des strauchförmigen Wuchses ist ein gelegentliches Auf-den-Stock-setzen oder Zurückschneiden, z.B. im 5-15jährigen, niederwaldartigen Umtrieb.
"Baumhecken" werden im Gegensatz zu Strauchhecken von mehr oder weniger dichten meist unregelmäßigen Baumreihen gebildet. In ihnen kommen vor allem Baumarten mit hoher Ausschlagfähigkeit vor wie Ahorn, Linde, Esche, Hainbuche, Eberesche, Espe, Birke u.a., die früher in einem mittelwaldartigen Umtrieb genutzt wurden: das Unterholz vor allem für die Brenn- und Flechtholzgewinnung, das Oberholz als Starkholz. Nach Aufgabe der Nutzung entwickelten sich viele von ihnen im Laufe der Zeit zu reinen Baumreihen.
Hecken lassen sich auch nach ihrer Größe einteilen:
Ferner unterscheidet man verschiedene Sonderformen, die nach ihrer Funktion oder Morphologie benannt sind, und die zum Teil typisch für bestimmte Regionen sind (z. B. Wallhecken, Flechthecken, Baumhage, Windschutzhecken, Schichtholzhecken, subspontane Hecken usw.).
Hecken können gezielt vom Menschen z.B. zur Feldabgrenzung angelegt, aber auch spontan durch Sukzession entstanden sein. Zunächst dienten Hecken dem Menschen zur Abgrenzung der eigenen Grundstücke („Hecke“ abgeleitet von althochdeutsch „Hag“ = Zaun) , zum Ausschluss des Weideviehs von den Äckern bzw. zum Einschluss des Weideviehs auf bestimmten Parzellen. Des weiteren lieferten Hecken Brenn- und Bauhholz, Beeren und Blätter. Insbesondere zur Versorgung mit Brennholz, aber auch um die Hecken dicht zu halten, wurden diese in regelmäßigen Abständen (8 – 15 Jahre) abschnittsweise „auf den Stock gesetzt“. Im 20. Jahrhundert wurden Hecken dann auch als Wind- und Erosionsschutz zur Ertragssteigerung zwischen Äckern gepflanzt. Sie werden mehr oder weniger regelmäßig durch Pflegemaßnahmen in einem bestimmten erwünschten Zustand erhalten oder auch zur Pflege der traditionellen Kulturlandschaft neu angelegt.
So verleihen Hecken heute noch manchen Landstrichen eine ganz eigene Prägung, wie z.B. die Knicks in Schleswig-Holstein, das Monschauer Heckenland, die Bocage-Landschaften Westfrankreichs oder auch (wie der Name schon sagt) das „Heckengäu“ in Baden-Württemberg.
In den wenigen Fluren, die unversehrt von der Bereinigung durch die moderne Agrarindustrie geblieben sind, bilden Hecken netzartig verbundene Grünzüge. Darin sind Äcker und Wiesen in buntem Wechsel eingebettet.
Hecken zählen zu den sogenannten Grenzbiotopen. Das sind Lebensräume, in denen die Arten verschiedener Biotoptypen aufeinandertreffen und sich zu besonders reichen Gemeinschaften verbinden. Im Fall der Hecken sind dies Arten von Wald und Wiese bzw. Acker.
Hecken haben nicht nur erhaltenswerte historische Kulturelemente, sondern insbesondere aus der naturschutzfachlichen Sicht sind sie von allergrößter Bedeutung. Dazu kommt ihre bodenkonservierende Funktion in winderosionsgefährdeten Gebieten.
Von der Wortbedeutung her hatten Hecken oder Hage ursprünglich wohl vor allem die Funktion, Saatfelder vor Weidevieh und Wild zu schützen oder Viehherden zusammenzuhalten: Das germanische Wort "hagh" bedeutet "einfassen". Die bis ins 19. Jh. übliche kollektive Weidenutzung der Allmenden setzte lebende Zäune (Hecken) geradezu zwingend voraus, denn sie mussten dauerhaft von den bestellten Äckern der Dorflur abgetrennt werden. Solche Zaunhecken wird man aktiv beschnitten, verflochten und wohl auch angepflanzt haben. Vermutlich ist nur noch ein sehr geringer Teil dieser einst weit verbreiteten Grenzhecken zwischen Gemeiner Weide, Triftwegen und Ackerflur erhalten geblieben. Der größte Teil ist bei den Gemeinheitsteilungen und Flurbereinigungen (Separationen) des 19. Jahrhunderts beseitigt worden.
(s. a. Bocage-Landschaft, Knick, Lesesteinhecke)
Hecken, Feldgehölze und Feldraine in der landwirtschaftlichen Flur sind keine zufälligen Bestandteile unsere Kulturlandschaft. Sie konnten sich auf schlecht nutzbaren Flächen als wertvolle Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt halten oder neu entwickeln.
Die drei Elemente umschließen Gärten und trennen Weiden von Ackerland, markieren Besitzgrenzen und sichern natürliche Geländekanten. Auf Lesesteinriegeln und künstlichen Böschungen, die sich durch Bewirtschaftung bildeten, konnten sie sich ebenfalls entwickeln. Sie sind also durch die landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Ihre Ausdehnung, ihr Verlauf und ihre Größe entwickelten sich in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung.
Daraus ergibt sich ihre heutige Gefährdung. Die Technisierung und Rationalisierung in der Landwirtschaft, bislang billige Rohstoffe und die Abwendung vom Selbstversorgungsprinzip ließen Hecken, Feldgehölze und Feldraine zu unproduktiven Bestandteilen werden, die oftmals ersatzlos beseitigt wurden.
Wo es im Jahre 1877 in Deutschland 133,4 m Hecke pro ha gab, waren es 1954 noch 93,75 m und 1979 nur noch 29,1 m. In Großbritannien förderte die staatliche Politik die Vernichtung von etwa 200.000 km Hecke.
Zunehmende Einsicht in die Bedeutung der drei Landschaftselemente tragen heute zu ihrem Erhalt und z.T. ihrer Wiederanlage bei.
Über diese direkten Nutzungen hinaus erfüllen Hecken, Feldgehölze und Feldraine weitere Aufgaben, die für die pflanzliche Produktion, den Naturhaushalt und das Landschaftsbild von Bedeutung sind. Hierzu gehören:

Quelle: Basedow 1990
Weitere Informationen:
Das Heckengäu ist eine ländlich geprägte Region in den baden-württembergischen Landkreisen Böblingen, Calw, Ludwigsburg und Enzkreis, die sich durch eine hügelige, stark landwirtschaftlich genutzte Landschaft auszeichnet.
Es bildet ein von Norden nach Süden über 50 km langgezogenes Band, das von Vaihingen an der Enz im Norden bis Haiterbach im Süden reicht. Im Westen grenzt es an den Nordschwarzwald und im Osten an das Korngäu und Strohgäu, den Glemswald sowie an den Schönbuch. Zusammen mit Korn-, Stroh- und Zabergäu bildet es das baden-württembergische Gäu.
Für das Heckengäu im Oberen Muschelkalk ist ein Wechsel von flachgründigen, steinigen Kalksteinböden mit mittel- und teils tiefgründigen Lehmböden prägend. Jahrhundertelang haben die Menschen Kalkschutt von den Äckern gelesen und entlang der Grundstücksgrenzen abgelagert. An den so entstandenen Lesesteinriegeln, an Hangkanten und anderen unbewirtschafteten Stellen haben sich Hecken angesiedelt, die dem Heckengäu den Charakter und den Namen gegeben haben. Die im östlichen Kreis Calw typischen Schlehenhecken geben der dortigen Region auch den Namen „Schlehengäu“.
Die kargen Kuppen und Hangkanten wurden auch als „Teufels Hirnschale“ bezeichnet und werden seit Jahrhunderten und teilweise heute noch als Schafweiden genutzt. Zeugen der Schafbeweidung sind auf diesen ökologisch wichtigen Magerrasen und Halbmagerrasen der Wacholder, die Zypressenwolfsmilch und die Silberdistel.
Die Landschaft des Heckengäus ist aufgrund der Geologie kleingliedrig strukturiert und daher sehr abwechslungsreich. Als Sträucher sind neben Schlehe, Weißdorn und Heckenrose auch Liguster, Hartriegel, Heckenkirsche und Hasel häufig anzutreffen. Feldgehölze werden von Wildkirsche, Feldahorn, Forche und Eiche geprägt. Mit einem geringen Waldanteil liegt das Heckengäu deutlich unter dem Landesdurchschnitt.
Um die Dörfer und Städte herum haben sich im Heckengäu oftmals noch ausgedehnte Obstwiesen erhalten. Diese binden die Ortschaften harmonisch in die Landschaft ein und bieten zudem eine Fülle gesunder Früchte. Obstwiesen sind zugleich biologische Pufferzonen – nämlich Rückzugs- und Ausweichquartiere für Pflanzen und Tiere zwischen Siedlungsraum und Feldflur.
Bei den Gäulandschaften handelt es sich um Altsiedelland, bei der Landschaft des Nordschwarzwaldes um Jungsiedelland. Typische Böden sind Rendzinen, in Geländemulden finden sich jedoch auch Lößauflagen, aus denen sich Parabraunerden bilden können. Die daraus resultierende landwirtschaftliche Nutzung durch Ackerbau, Weidewirtschaft und Obstbau prägt das Landschaftsbild. So finden sich im Heckengäu Wacholderheiden, Streuobstwiesen sowie Feldhecken.
Natürlich und/oder anthropogen bedingte Landschaft mit einer mehr oder weniger lockeren Strauch- bis Zwergstrauchformation auf gewöhnlich armen Standorten. Charakterpflanze ist das Heidekraut (Calluna vulgaris). Klimatisch bedingt kann Heide beispielsweise im nordatlantischen Bereich, am Übergang vom Wald zur Steppe im kontinentalen Bereich, oder an den oberen Waldgrenzen im Hochgebirge auftreten. Als Kulturlandschaft tritt Heide auf, wenn die Holzgewächse durch verschiedene Formen der Landnutzung niedrig gehalten werden.
In der Jungsteinzeit vor ca. 5.000 Jahren entstanden beispielsweise die ersten Calluna-Heiden NW-Deutschlands. Sie besaßen um 1800 ihre größte Ausdehnung. Noch 1832 war etwa die Hälfte des heutigen Niedersachsens Heide.
Heute gilt die nur in kleinen Resten erhaltene Heidelandschaft NW-Deutschlands als Museumslandschaft, die Zeugnis gibt über vorindustrielle Lebens- und Kulturformen.
(s. a. Plaggen, Plaggenesch)
Das Heidekraut (Calluna vulgaris), auch Besenheide genannt, ist die einzige Art der monotypischen Pflanzengattung Calluna, die zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) gehört. Sie ist eine prägende Pflanzenart der Heidelandschaft. Die Besenheide ist Blume des Jahres 2019.
Heidekraut ist ein 20–100 cm hoher, immergrüner Zwergstrauch mit niederliegenden Sprossen und kleinen, lineal-lanzettlichen, 4zeilig angeordneten Blättern an aufstrebenden, reichverästelten Zweigen. Die in reichblütigen, einseitswendigen Trauben stehenden 4zähligen, bleibenden Blüten besitzen eine hellviolettrosa Blütenkrone und doppelt so lange, strohartige Kelchblätter gleicher Farbe.
Natürlich verbreitet ist die Besenheide in ganz Europa mit Schwerpunkt in Mittel- und Nordeuropa, im Osten kommt sie bis Westsibirien vor. Besonders häufig ist sie in eiszeitlich geprägten Gebieten. Schottische Einwanderer führten die Besenheide im 19. Jahrhundert nach Kanada ein. Seitdem breitet sie sich in Nordamerika aus und gilt dort als Neophyt. Die Besenheide gilt als Säurezeiger. Sie kommt natürlich auf sonnigen bis lichten Standorten, vornehmlich auf kalkfreien Sanden vor. Sie wächst bevorzugt auf trockenen, aber auch auf wechselfeuchten, nährstoff- und basenarmen Böden, beispielsweise in entsprechenden Bereichen von Mooren. Lebensraum sind Heiden, Moore, Dünen, Magerweiden, lichte Eichen- und Kiefernwälder.
Die Besenheide kommt vom Flachland bis in Höhenlagen von 2700 Metern vor. In den Allgäuer Alpen steigt die Besenheide im Tiroler Teil an der Mutte oberhalb Bernhardseck bis zu einer Höhenlage von bis zu 2100 Meter auf. Im Tessin kommt sie an der Fibbia sogar bis etwa 2700 Meter Meereshöhe vor. Nordwärts findet man sie in Norwegen bis 71° 5' nördlicher Breite
Die Besenheide stellt in der Imkerei eine wichtige Bienenweide dar, denn ihr Nektar enthält 24 % Zucker, überwiegend Saccharose, und jede einzelne Blüte produziert durchschnittlich 0,12 mg Zucker täglich. Der von den Bienen aus ihrem Nektar gewonnene Heidehonig zeichnet sich durch eine gallertartige Konsistenz aus. Für Weidetiere wie Schafe, Ziegen und Rinder bietet die Besenheide nur geringe Futterwerte und hat eine geringe Futterattraktivität. Am ehesten sind noch Schafe in der Lage, Besenheide-geprägte Lebensräume (z. B. Lüneburger Heide) zur Gewichtszunahme zu nutzen, wobei sich einige Rassen besonders eignen (z. B. Heidschnucke). Das Ertragsniveau bleibt allerdings niedrig. Es kann durch die Beimischung von Ziegen geringfügig verbessert werden. Die Bewirtschaftung Besenheide-geprägter Lebensräume muss in der heutigen landwirtschaftlichen Ordnung in Mitteleuropa allerdings immer durch die öffentliche Hand finanziell unterstützt werden. Ohne den Einfluss der Beweidung (oder anderer Pflegeverfahren) überaltern Besenheidebestände und verlieren damit an Wert für den Biodiversitätsschutz.
Die Besenheide ist für Wildpflanzengärten zu empfehlen und zur Begrünung sandiger Böschungen geeignet. Sie ist auch eine beliebte Zierpflanze, die als „Calluna(heide)“ oder „Sommerheide“ in etwa 10.000 Sorten mit sehr unterschiedlichen Blütezeiten und Färbungen der Blüten und Blätter kultiviert wird.
Die Besenheide wird auch zur Firstverkleidung von reetgedeckten Dächern verwendet. Aufgrund der sehr langen Haltbarkeit im Außenbereich wird sie auch zu Sicht-, Wind- und Lärmschutzelementen zusammengebunden. Besenheide trotzt allen Witterungsverhältnissen und bleibt daher über lange Jahre beständig.
Namensgebend ist allerdings die Nutzung der Besenheide in der Besenbinderei. Noch in den 1980er Jahren wurden solche Besen in der Teerindustrie verwendet. Unter anderem waren diese Besen industriell gefertigten Besen durch ihre Temperaturbeständigkeit überlegen.
Die Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) ist eine Art aus der Gattung der Heidelbeeren (Vaccinium) in der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae).
Die Heidelbeere wird regional auch Besinge oder Besing genannt, weitere mundartliche und regionale Namen sind Blaubeere, Schwarzbeere, Mollbeere, Wildbeere, Waldbeere, Bickbeere, Staulbeere (Pfalz und Saarland), Zeckbeere, Moosbeere oder (besonders auch schweizerisch und süddeutsch) Heubeere
Die in der Heidelbeere enthaltenen Anthocyane sind Antioxidantien und färben beim Verzehr Mund und Zähne blau bis rot.
Der 10 bis 60 cm hohe Zwergstrauch wächst stark verzweigt mit aufrechten, kantigen bis schmal geflügelten, grün gefärbten Ästen, die kahl (unbehaart) sind. Die Laubblätter sind 2 bis 3 cm lang, eiförmig bis elliptisch, drüsig gesägt bis fein gezähnt und beiderseits grasgrün.
Die häufig im Supermarkthandel erhältlichen Kulturheidelbeeren stammen dagegen nicht von der in Europa heimischen Heidelbeere ab, sondern von der Amerikanischen Heidelbeere (Vaccinium corymbosum) und anderen nordamerikanischen Arten. Sie erzeugen, da ihr Fruchtfleisch hell ist, keine Blaufärbung im Mund, sofern sie unverarbeitet verzehrt werden.
Von der Amerikanischen Heidelbeere (Vaccinium corymbosum) unterscheidet sich die eurasische Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) dadurch, dass sich die farbgebenden Anthocyane sowohl in der Schale als auch im Fruchtfleisch befinden und sie so durch und durch blau gefärbt ist. Bei der seit etwa 1900 aus der Amerikanischen Heidelbeere gezüchteten Kulturheidelbeere befinden sich die Farbstoffe nur in der Schale, weshalb diese ein helles Fruchtfleisch aufweist und keine „blauen Zähne“ verursacht. Außerdem ist die Kulturheidelbeere doppelt bis mehrfach so groß wie die echte Heidelbeere und schmeckt weit weniger aromatisch als die Wildfrüchte, ist dafür aber länger lagerfähig.
Die Kulturheidelbeeren sind mit großer Sortenvielfalt durch Züchtungen aus Pflanzenarten der Untergattung oder Sektion Cyanococcus in der Gattung der Heidelbeeren (Vaccinium) hervorgegangen. Kulturheidelbeeren stammen nicht, wie häufig angenommen, von der in Europa heimischen Heidel-, Blau- oder Waldheidelbeere (Vaccinium myrtillus) ab, deren Früchte Mund und Lippen beim Verzehr blau färben, sondern sind nordamerikanischen Ursprungs. Die färbenden Anthocyane befinden sich bei ihnen in der Fruchtschale der fast kugelrunden, blauen Beeren; ihr Fruchtfleisch ist weiß.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden über 100 neue Sorten kultiviert. Kulturheidelbeeren sind als Marktfrüchte weltweit von Bedeutung.
Heidelbeeren sind eine beliebte Beerensorte für die menschliche Ernährung. Sie lassen sich sowohl frisch verzehren als auch in der Küche verwerten. Anthocyane in der Heidelbeere sind für ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften verantwortlich.
Vor ihrem Anbau als Obstlieferant war die Kulturheidelbeere bereits aufgrund ihrer dekorativen Herbstfärbung im europäischen Garten- und Landschaftsbau als Zierpflanze eingeführt worden.
2022 betrug die Welternte 1.228.595 Tonnen, wobei die entsprechenden Statistiken nicht nach genauer Artzugehörigkeit aufgeschlüsselt sind. 25,8 % der Welternte wurden in den Vereinigten Staaten gepflückt, mehr als in jedem anderen Land der Welt. In Europa wurden 16,9 % der Welternte gepflückt. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland auf einer Fläche von insgesamt rund 3.469 Hektar Kulturheidelbeeren angebaut. Die Erntemenge belief sich auf über 15.322 Tonnen. Die Kulturheidelbeere gehört zu den wichtigsten Strauchbeerenobstsorten in Deutschland.
Trotz gewachsener Anbaufläche und Erntemenge reicht die heimische Produktion nicht aus: Nur gut 20 Prozent des Verbrauchs werden durch Heidelbeeren aus Deutschland gedeckt. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei etwa 800 Gramm im Jahr – und ist seit Jahren stabil. Die Saison für frische heimische Heidelbeeren dauert von Juni bis August. Außerhalb dieser Zeit kommen sie vor allem aus Peru, Spanien, Marokko und Polen.
Weitere Informationen:
Insbesondere bei krautigen Heilpflanzen ist die Bezeichnung Heilkraut üblich.
Weitere Informationen:
Nutzpflanzen, die die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe zu Heilzwecken oder als Arzneipflanze zur Linderung von Krankheiten innerlich oder äußerlich verwendet werden. Sie können als Rohstoff für Phytopharmaka in unterschiedlichen Formen, aber auch für Teezubereitungen, Badezusätze und Kosmetika eingesetzt werden.
Insbesondere bei krautigen Heilpflanzen ist auch die Bezeichnung Heilkraut üblich. Manche Heilpflanzen sind zugleich Giftpflanzen.
Heilpflanzen werden meist in getrockneter und zerkleinerter Form (als sog. Droge) verwendet, wobei entweder die ganze Pflanze oder nur bestimmte Teile verarbeitet werden: Blätter, Blüten, Frucht, Rinde, Samen, Wurzel, Wurzelstock. Wirkstoffe der Heilpflanzen sind in erster Linie Alkaloide, Glykoside, etherische Öle und die heterogene Gruppe der Gerbstoffe und Bitterstoffe (Pflanzenstoffe).
Der je nach Entwicklungszustand, Herkunft und Sammeljahr wechselnde Gehalt an Wirkstoffen hat dazu geführt, dass heute die meisten stark wirksamen Inhaltsstoffe chemisch isoliert oder dass die Drogen durch Mischung auf einen bestimmten Wirkstoffgehalt eingestellt werden. Auch heute noch sind Heilpflanzen (wegen der hohen Komplexität der Wirkstoffe) der Ausgangspunkt zur Herstellung von ca. 55% aller Arzneimittel. Der noch bei weitem nicht vollständig erfasste Bestand an Pflanzen mit pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoffen in den tropischen Wäldern ist einer der wahren Schätze der Menschheit. Neben gesicherten Erfahrungen spielten dabei psychologische Effekte und magisch-religiöse Vorstellungen eine bedeutende Rolle.
Neben vielen Pflanzen, die in der pharmazeutischen Industrie als Lieferanten bestimmter Wirk- und Ausgangsstoffe dienen, gelten derzeit nach dem Deutschen Arzneibuch (DAB) bzw. den Europäischen Arzneibüchern etwa 80 Arten als offizinelle Heilpflanzen. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Pflanzen aus feldmäßigem, kontrolliertem Anbau. Heilpflanzen (Arzneipflanzen, Heilkräuter) werden dabei nach wissenschaftlichen Methoden zu standardisierten Fertigprodukten (Phytotherapeutika) aufbereitet und dann auch in der Schulmedizin genutzt (sogenannte Moderne oder Rationale Phytotherapie).
Heilpflanzen sind zudem eine wichtige Komponente in vielen alternativen Heilverfahren wie der Homöopathie, Bach-Blütentherapie, Aromatherapie oder Ayurvedischen Medizin.
In der Heilpflanzenkunde (Phytopharmakognosie) unterscheidet man folgende Begriffe:
„Heilpflanze“ ist dabei ein funktioneller Begriff, der nur nach dem Zweck verwendet wird, ungeachtet der botanischen Zugehörigkeit oder der Wuchsform. Jede Pflanze, für die der pharmazeutischen Biologie eine entsprechende Anwendung als Medikament bekannt ist, kann als Heilpflanze bezeichnet werden. Gelegentlich werden auch Pilze, Flechten und Algen zu den Heilpflanzen gezählt.
Manche Pflanzen, die ursprünglich wichtige Heilkräuter waren, werden heute als Genussmittel verwendet (etwa Tee, Kaffee oder Tabak) oder als Küchenkräuter (Gewürzkräuter, z. B. Pfeffer, Zimt, Basilikum) oder als schlichte Nahrungsmittel (Apfel, Zitrusfrüchte).
Auch Heilpflanzen werden zu den nachwachsenden Rohstoffen gezählt, da ihre Verwendung außerhalb des Nahrungs- und Futtermittelbereichs stattfindet. Zusammen mit Färberpflanzen beträgt die Anbaufläche in Deutschland rund 12.000 ha (ca. 0,5 % der Gesamtanbaufläche für nachwachsende Rohstoffe). Etwa 90 % der in Deutschland verwendeten Heilpflanzen werden importiert. Heilpflanzen stammen allerdings nur zu 30 % aus Anbau und zu etwa 70 % aus Wildsammlungen. Von den etwa 440 heimischen Heilpflanzen werden in Deutschland ca. 75 Arten angebaut, wobei allein 24 Arten 92 % des Angebots ausmachen. Hauptanbaugebiete in Deutschland sind Thüringen (Erfurter Becken), Bayern (Oberbayern, Erdinger Moos, Mittelfranken), Sachsen (Lößgebiete Mittelsachsens), Sachsen-Anhalt (Mitteldeutsches Trockengebiet) und Ostfriesland.
Weitere Informationen:
Vieldeutiger und in ständiger Diskussion befindlicher Begriff, der zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum verweist. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf die Umgebung mit ihren regional besonderen Eigenarten angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen.
Heimat bedeutet für viele Menschen etwas Schönes. Sie denken an den Ort, wo sie aufgewachsen sind, an ihre Kindheit, an die Familie und an vertraute Freunde aus der Schulzeit. Es ist ein Ort, wo sich Menschen geborgen und verstanden fühlen.
So verbindet sich das Gefühl von Vertrautheit und Sehnsucht für viele Menschen mit der Heimat. Manche haben Heimweh, wenn sie fort aus der Heimat sind. Andererseits sprechen Menschen von einer „Wahlheimat“, wenn sie an einem Ort leben, wo sie sich wohl fühlen.
Im Feld der Politik wird der Begriff 'Heimat' oft verbunden mit dem Hinweis auf gemeinsame Werte, die die Menschen verbinden. In einer offenen und demokratischen Gesellschaft geht es deshalb darum, diese Werte zu stärken, die auch in westlichen Verfassungen ihren Ausdruck finden. Dann kann ein Land auch eine Heimat für Menschen sein, die zwar nicht hier geboren sind, aber hier leben, arbeiten und sich für Gesellschaft und ihre Menschen einsetzen.
Der Begriff 'Heimat' findet aber auch in einem übertragenen, metaphorischen Sinne Verwendung, etwa in der Bedeutung 'geistige Heimat'.
Die Landwirtschaft hat einen notwendigerweise engen Bezug zu dem Produktionsfaktor Boden, den zugehörigen Wohn- und Wirtschaftsbauten und ihrer sozialen, oft dörflichen Einbindung. Dies fördert seit jeher die identitätsstiftende Entstehung von kulturellen Ausprägungen wie vielfältiges Brauchtum, regionaltypische Feste (Erntedank), Bekleidung (Trachten) oder Musik. Kaum eine Zivilisation ist ohne ihre besondere Agrar- und Ernährungskultur denkbar. Entsprechend kann Landwirtschaft über Schönheit, Eigenheit, Geschmack, Geschichte und Tradition von Regionen und Kulturlandschaften unsere Identität bis hin zu spirituellen Werten formen, vorausgesetzt sie bietet nicht auf Irrwegen seelenlose ausgeräumte Landschaften.
Reimar von Alvensleben von der Universität Kiel hat 1999 nachgewiesen, dass man im Regelfall davon ausgehen kann, dass Konsumenten Produkte aus „ihrer“ Region bevorzugen. Dies liege an dem „menschlichen Bedürfnis nach überschaubarer und identitätsstiftender Umwelt. Die Vertrautheit mit einer Region gibt dem Menschen Sicherheit und schafft Sympathie für die Region (Kontakt-Affekt-Phänomen).“
Letztlich erzeugen Heimatgefühle den Eindruck bei Verbrauchern, dass Produkte aus der eigenen Region generell besser seien als Produkte mit anderer geographischer Herkunft. Dieser Sachverhalt führt zu einem Boom bei Produkten, für die mit der Eigenschaft „aus der Region für die Region“ geworben wird. (s.a. geschützte geografische Angabe)
Dass das subjektive Gefühl, ein Produkt „aus der Ferne“ könne nicht qualitativ gut sein, falsch sein muss, wird allein schon dadurch deutlich, dass nur ein Produkt einer bestimmten Warengattung objektiv „das beste in Deutschland, europaweit oder weltweit“ sein kann, so dass alle, die nicht im Nahbereich des Herstellungsortes dieses Produkts wohnen, sich irren müssen. Richtig ist allerdings, dass lange Transportwege, z. B. bei Lebensmitteln, die Frische einer Ware beeinträchtigen können.
Als Heimataspekt erscheinen in diesem Zusammenhang die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend untergegangenen Produktions- und Lebensweisen in der Landwirtschaft und der vorindustriellen Produktion.
Obwohl die Landwirtschaft von der Industrialisierung erfasst wurde, galt das Bauerntum um 1900 als „ursprünglich“, als „gesunde und beharrende Kraft“. So entstand um 1900 herum die Heimatliteratur, die der Trivialliteratur zugeordnet wird.
Gerüste aus Pfählen mit Querholmen zur Lufttrocknung von Grasschnitt.
Maß für den gesamten Einfluss des Menschen auf natürliche Ökosysteme. Die aus den griechischen Wörtern hémeros (gezähmt, kultiviert) und bíos (leben) gebildete und erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts benutzte Bezeichnung kann etwa mit Kultivierungsgrad übersetzt werden.
Die Hemerobie stellt die Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt dar. Sie kann herangezogen werden, um Bereiche der Landschaft von besonders hoher Naturnähe zu bestimmen, deren Vegetation von einer relativ geringen menschlichen Einflussnahme geprägt ist. Hier treten natürliche Prozesse zunehmend in den Vordergrund. So können auch mittlerweile selten gewordene Arten auftreten, die geringere Bewirtschaftungsintensitäten benötigen. Je nach Intensität der anthropogenen Wirkungen können mehrere Hemerobiestufen unterschieden werden. Bei Ökosystemen der niederen Hemerobiestufen überwiegt die Steuerung durch natürliche, bei Ökosystemen der oberen Hemerobiestufen die Steuerung durch anthropogene Prozesse.
Als Referenz für die Einordnung aktueller Landnutzungsformen wird der Endzustand einer Sukzession im Sinne der potenziellen natürlichen Vegetation (pnV) herangezogen. Im Gegensatz dazu nimmt das Konzept der Naturnähe die ursprüngliche natürliche Vegetation als Referenz an. Während die ursprüngliche natürliche Vegetation die rekonstruierte Vegetation vor dem Sesshaftwerden des Menschen darstellt, gibt die pnV die Vegetation wieder, die sich schlagartig einstellen würde, wenn jegliche menschliche Einflüsse unterblieben. Das Konzept der Hemerobie ist demgegenüber aktualistisch ausgerichtet und gleicht einem Standortpotenzial, da es durch den Bezug auf die pnV irreversible Standortveränderungen berücksichtigt.
Es werden sieben Hemerobiestufen unterschieden, wozu Hemerobieindikatoren herangezogen werden. Je höher der Wert, desto größer ist der Eingriff des Menschen in die Landschaft. Der Wert 7 steht für eine vollständig versiegelte, also überbaute Fläche, der Wert 1 für ein vom Menschen gänzlich unbeeinflusstes Gebiet. Der Begriff bezog sich ursprünglich auf den Anteil der Neophyten (eingebürgerte Pflanzen seit 1500 n. Chr.) in der regionalen Flora. Diese Klassifikation wurde z.B. bei einer Ökotopkartierung Hollands im Maßstab 1:200.000 angewendet. Die Hemerobie wurde dabei in bezug zur potentiell natürlichen Vegetation (pnV) dargestellt. In der europäischen Kulturlandschaft sind kaum mehr natürliche, d.h. gänzlich unbeeinflusste Landschaften vorzufinden. In mehr oder weniger starkem Ausmaß hat der Mensch fast überall in die natürliche Umwelt eingegriffen. Damit übernahm er in landschaftlichen Ökosystemen eine wesentliche Reglerfunktion. Seit dem Zeitalter des Ackerbaus hat der Mensch begonnen, die Landschaft regional für seine Nutzen umzugestalten, was v.a. in der Veränderung des natürlichen Vegetationskleides zum Ausdruck kam. Seit der Industriellen Revolution im 18. Jh. greift der Mensch eine Stufe tiefer in den Naturhaushalt ein, indem z.B. zugunsten der Siedlungsentwicklung das natürliche Vegetationskleid großflächig entfernt wurde. Durch Versiegelung, Veränderungen des Großreliefs (z. B. Braunkohle-Tagebau), Einsatz von Agrarchemikalien und industrieller Schadstoff-Emmissionen wurde der Landschaftshaushalt großräumig verändert bis destabilisiert. Städtische Systeme können nur noch aufrecht erhalten werden mittels hohem Energieeinsatz für Ver- bzw. Entsorgung.
Weitere Informationen:
Hemicellulose ist ein in pflanzlicher Biomasse vorkommender Vielfachzucker. Er ist ein Bestandteil pflanzlicher Zellwände, deren Matrix aus fibrillärer, teilweise kristalliner Cellulose besteht. Diese fibrilläre Matrix wird bei der Verholzung zusätzlich von dem Makromolekül Lignin durchdrungen. Dadurch wird Lignocellulose gebildet.
Die Hemicellulose bildet somit einen Teil der Stütz- und Gerüstsubstanz von Zellwänden und macht 25 – 33% der Pflanzenmasse aus.
Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung unerwünschter Wildkräuter, Wildgräser und Gehölze. Die Herbizide sind die quantitativ bedeutendste Gruppe von Pestiziden geworden. Herbizide Wirkstoffe werden in Deutschland vorwiegend im Getreide-, Rüben-, Mais-, Raps- und Kartoffelbau angewendet, weniger im Grünland. Herbizide wirken entweder allgemein ätzend oder aber hemmend auf die Zellatmung, Keimung oder Photosynthese oder sie wirken als Wuchsstoffe.
Je nach Zielgruppe unter den zu bekämpfenden Pflanzen kann von Graminiziden (gegen unerwünschte Gräser und andere Einkeimblättrige), Arboriziden (gegen unerwünschte Holzgewächse) oder Algiziden sprechen. Die Fungizide, die gegen Pilze wirken, werden nicht zu den Herbiziden gezählt, obwohl die Pilze traditionellerweise als Pflanzen betrachtet werden. Kontaktherbizide wirken nur an den direkt benetzten Pflanzenteilen. Wuchsstoffe führen zu übersteigertem Wachstum, Mißbildungen, Stoffwechselstörungen und Absterben der Wildkräuter. Mittel, die nur das Abfallen der Blätter bewirken, heißen Entlaubungsmittel oder Defolianten. Bodenherbizide wirken überwiegend über die Wurzeln. Selektivherbizide richten sich nur gegen bestimmte Pflanzen oder Pflanzengruppen,
Totalherbizide wirken mehr oder weniger gleichmäßig gegen alle höheren Pflanzen und gelangen z.B. auf Wegen und Gleisanlagen zum Einsatz. Nach dem Zeitpunkt der Anwendung unterscheidet man Vorsaatherbizide, Vorauflaufherbizide und Nachauflaufherbizide. Die meisten Herbizide werden im Nachauflauf-Verfahren angewendet. Dieses hat den Vorteil, dass die Unkrautdichte und das Artenspektrum zum Zeitpunkt der Behandlung bekannt sind, und dass damit entschieden werden kann, welches Herbizid am geeignetsten ist und ob eine Bekämpfung überhaupt nötig und lohnend ist (Schadschwelle). In der Regel werden Flächenbehandlungen durchgeführt, bei weitstehenden Kulturen (Zuckerrübe, Mais) können auch streifenförmige Bandbehandlungen erfolgen.
Gentechnisch gezielt manipulierte Eigenschaft von Kulturpflanzen gegen einen neuen Typ von nicht-selektiven (NSH), wirtschaftlich interessanteren und angeblich ökologisch günstigeren Herbiziden unempfindlich zu sein (z.B. "Basta" oder "Roundup"). Man verspricht sich von der HR-Technik eine genauere Anwendung der Herbizide gegen konkurrierende Wildkräuter, da sie erst dann ausgebracht werden müssen, wenn diese Unkräuter zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Kulturpflanzen zu werden drohen. Die bodenschützende Wirkung der Ackerkräuter bleibt so länger gewährleistet. Außerdem erspart ein Breitbandherbizid das Ausbringen von mehreren Herbiziden gegen ein jeweils kleines Spektrum von unerwünschten Wildkrautarten. Bei den derzeit kommerziell genutzten gentechnisch veränderten Pflanzen ist Herbizidresistenz das bei weitem dominierende Merkmal.
Die meisten in der konventionellen Landwirtschaft verwendeten Herbizide sind „selektiv“: Sie zerstören nur bestimmte Pflanzenarten. Für jede Kulturpflanze und die jeweiligen Begleitkräuter muss eine geeignete Kombination von Herbizidwirkstoffen gefunden werden.
Freisetzungsversuche mit der HR-Technik betreffen in Deutschland Zuckerrüben, Raps und vor allem Mais. Mit transgenem Mais erhofft man sich einen umweltverträglicheren Anbau: Mais reagiert insbesondere im Frühsommer sehr empfindlich auf Konkurrenz durch Unkräuter, die Kultur muß daher bislang sehr früh und über lange Zeit mit Herbiziden behandelt werden. Der so erreichte geringe Bedeckungsgrad des Bodens führt im Frühsommer häufig zu großen Erosionsproblemen. Durch die sogenannte Mulchsaat von Mais kann dieser Nachteil erheblich verringert werden. Dabei wird der Mais in eine Bodenoberfläche eingesät, die von lebenden oder bereits abgestorbenem Pflanzenmaterial bedeckt ist. Diese "Bodendecker" können bereits im Herbst eingesät werden und schützen den Boden auch während der Wintermonate vor Bodenerosion. Derartige Mulchsaatsysteme sind bislang mit Mehrkosten und Ertragseinbußen verbunden. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Begrünung zur Konkurrenz für Mais wird, erfolgt der Basta-Einsatz.
Herbizidresistenz erleichtert auch die Einführung der bodenschonenden Bodenbearbeitung mit Direktsaat, bei der das u.a. der Unkrautbekämpfung dienende Pflügen entfällt.
Neben dem Erosionsschutz erwarten die Befürworter der HR-Technik auch eine Reduzierung der ausgebrachten Herbizidmengen, da deren Einsatz nicht mehr prophylaktisch, sondern gezielt erfolgen kann.
Weitere Informationen:
Siehe Herbizidresistenz
Der Begriff bezeichnet die hohen Erträge und günstigen Eigenschaften bei Hybridsorten. Diese Mehrleistung gegenüber der Elterngeneration tritt in hohem Ausmaß nur in der F1-Generation auf und ist um so ausgeprägter, je reinerbiger und je weniger verwandt die Kreuzungspartner sind.
Der Heterosiseffekt wird in der Hybridzüchtung genutzt. Die Hybride, die aus der Kreuzung zweier Inzuchtlinien hervorgehen, sind leistungsfähiger als die Eltern: Sie sind vitaler, größer oder widerstandsfähiger. Bei den Nachkommen dieser Hybride tritt der Heterosiseffekt nicht mehr auf.
Der Heterosiseffekt ist unter anderem bei Mais, Roggen, Sonnenblume, Zuckerrüben, Zwiebeln, Gurken, Blumenkohl, Fichten, Kiefern, Lärchen und Pappeln bekannt.
(s. a. Hybridzüchtung)
Grasschnitt, der auf dem Feld oder maschinell getrocknet wird (Futterkonservierung). Heu wird im Winter zur Fütterung von Wiederkäuern und Pferden eingesetzt. Geerntet werden Wiesen mit Gras und Wiesenkräutern, aber auch Ackerflächen mit Raps, Grünroggen, Klee und Luzerne. Wiesen werden ein bis fünf Mal pro Jahr geschnitten. In der Regel wird nur der erste Schnitt als Heu bezeichnet, alle folgenden heißen Grummet. Mähmaschinen werden von einem Traktor gezogen, mit Heuwendemaschinen wird das Mähgut mehrfach gewendet, anschließend auf Schwad (in Reihen) gelegt und zu Ballen gepresst.

Quelle: privat
Feldgetrocknetes Heu hat normalerweise einen relativ geringen und stark schwankenden Futterwert. Der Nährwert von maschinengetrocknetem Heu ist demgegenüber wesentlich höher. Wegen der schwankenden Heuqualitäten und der größeren Witterungsabhängigkeit des Heus wird heute der größte Teil des Grundfutterbedarfs für die Winterfütterung durch Silagen aus Grünfutter gedeckt. Ein völliger Verzicht auf Trockengrundfutter in der Milchviehhaltung und Jungviehaufzucht ist aber nicht zweckmäßig.
(s. a. Gerüsttrocknung)
Weitere Informationen:
Niederdeutsche Bezeichnung für eine agrarsoziale Gruppe, die in der zweiten Hälfte des 16. Jh. entstand. Die oberdeutschen Entsprechungen sind Kleinhäusler und Seldner. Bei fehlendem oder nur geringem Eigenbesitz wurden von den Heuerlingen kleinere Ländereien der Altbauern als Pachtland bewirtschaftet, die Pachtzahlung bestand in Arbeit auf dem Altbauernhof. Sie wohnten in Nebengebäuden der Altbauerngehöfte und trugen zur Dorfverdichtung bei.
Gerüst aus gegeneinandergestellten Lattenrosten zur Lufttrocknung von Grasschnitt.
(s. a. Gerüsttrocknung)
Heulage, auch Gärheu genannt, ist ein staubarmes, milchsauer vergorenes Raufutter mit mittlerem Feuchtegehalt, das besonders in der Pferdehaltung als Alternative zu Heu und Silage genutzt wird.
Während beim Heu gemähtes Gras durch Trocknung konserviert wird, gärt es für die Heulage. Das heißt, das gemähte Gras wird kurz getrocknet und dann mit einem Restfeuchtegehalt von 40 bis 50 Prozent gepresst und luftdicht in Wickelfolie verpackt. Dadurch wird das Gras milchsauer vergoren, dabei wird Zucker in Säure umgewandelt. Dieser Vorgang konserviert das Gärheu, macht es also haltbar.
Heumilch unterscheidet sich hinsichtlich der Fütterung von herkömmlicher Milch, bei Weidemilch gilt dies für die Haltung. Heumilch stammt von Kühen, die nicht mit Silage, sondern mit frischem Grünlandfutter, Heu und Getreide gefüttert wurden. Die Bezeichnung "Heumilch" ist seit 2016 EU-weit rechtlich geschützt. Heumilch wird mit dem EU-Zeichen "garantiert traditionelle Spezialität" (g. t. S.) gekennzeichnet, dafür müssen Produzentinnen und Produzenten gewisse Produktionsstandards erfüllen, die vor allem zur silofreien Fütterung der Milchkühe konkrete Vorgaben enthalten.
Als 'High Country' werden in Neuseeland hoch gelegene, ländliche Gegenden bezeichnet. Dabei wird der Begriff meist nur mit den südöstlichen Teilen der Südinsel in Verbindung gebracht, in abgeschwächter Weise auch mit dem Inneren der Nordinsel.
Konkret sind mit "High Country" meist Central Otago und das Mackenzie-Becken auf der Südinsel sowie teilweise das Volcanic Plateau auf der Nordinsel gemeint. Alle diese Gebiete sind durch geringe Niederschläge, eine sehr dünne Bevölkerungsdichte und eine Höhenlage von meist über 600 m charakterisiert. Erstere befindet sich im Regenschatten der Neuseeländischen Alpen und die Hochebene wird von den drei Vulkanen vor hohen Niederschlagsmengen bewahrt. Des Weiteren herrscht in all diesen Gebieten kontinentales Klima mit kalten Wintern und heißen Sommern.
Die meist von Tussockgras bewachsenen Flächen dienen häufig der extensiven Weidewirtschaft und ähneln bis auf die teilweise hügelige Bodenbeschaffenheit einer Steppe. Als Weidevieh dienen hauptsächlich Schafe, in letzter Zeit aber auch immer mehr Hirsche und Alpakas.
Das High Country kann in etwa mit dem Outback in Australien, dem High Veld in Südafrika und der Pampa in Argentinien verglichen werden und gilt als Synonym für Abgeschiedenheit.
Einer von 35 EU-Indikatoren zur Integration von Umweltbelangen in die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Ziel ist die, für diese Region „typische“ Landschaft zu erhalten. „Flächen mit hohem Naturwert“ (High nature value farmland; HNV-Farmland) sind z.B. artenreiches Magergrünland, extensiv bewirtschaftete Äcker oder Weinberge sowie Brachen. Sie verfügen in der Regel nicht nur über eine höhere Artenvielfalt, sondern beherbergen auch seltenere und spezialisiertere Tier- und Pflanzenarten, welche in der intensiv genutzten Landschaft keine Überlebenschancen mehr haben. Auch die Agrarlandschaft strukturierende Landschaftselemente wie Gräben, Feldgehölze oder Trockenmauern, welche zusätzliche Lebensräume für viele Arten bieten, zählen zu den höherwertigen Agrarflächen. Im Sinne des Erhalts der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft ist es von großer Bedeutung, mit Hilfe von Förderinstrumenten Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die HNV-Farmland-Flächenkulisse zu erfassen und deren Entwicklung über die Zeit zu beobachten. Dadurch können Erfolge und Misserfolge bei den Anstrengungen zur Verbesserung der Umweltsituation in der Landwirtschaft, die von den Ländern, dem Bund und der Europäischen Union unternommen werden, abgebildet werden.
In Deutschland wurden folgende Wertstufen für HNV Farmland Elemente eingeführt:
Äcker des ökologischen Landbaus erreichten in Deutschland 2017 (BÖLW 2018) zu 87 % eine der drei Wertstufen, 56 % sogar die Stufen I und II, welche einen äußerst hohen bis sehr hoher Naturwert bedeuten. Bei den konventionell bewirtschafteten Äckern schafften es lediglich 3 % in Stufe III mit mäßig hohem Naturwert.
Weitere Informationen:
Die Himbeere (Rubus idaeus) ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die vielfältige Nutzung der Pflanze durch den Menschen spiegelt sich in zahlreichen regionalen Volksbezeichnungen wider.
Die Himbeerpflanze besitzt ein mehrjähriges, flaches Wurzelsystem, aus dem 1,5-2 m lange, aufrecht wachsende Ruten hervorgehen. Es handelt sich um Halbsträucher. Bei Halbsträuchern verholzen die unteren Teile der Pflanze, die Zweige im oberen Teil bleiben krautig und sterben im Winter ab. Himbeeren sind Sammelfrüchte. Die 20-30 Einzelbeeren gruppieren sich um den Blütenboden und lösen sich bei Vollreife vom Zapfen. Sie sind selbstfruchtbar.
Himbeeren haben einen sehr hohen Vitamingehalt. Aufgrund des günstigen Zucker-Säure-Verhältnisses können größere Mengen gegessen werden ohne Magenbeschwerden befürchten zu müssen. Ihr hoher Salicylsäuregehalt wirkt schweißtreibend, temperatursenkend und entzündungshemmend. Aufgrund ihres einzigartigen Aromas gehören Himbeeren zu den köstlichsten Früchten für den Frischverzehr.
Legenden zufolge ist die Heimat der Himbeere die Insel Kreta. Die ersten Himbeeren wurden wahrscheinlich im Mittelalter von Mönchen in Klostergärten kultiviert. Ende des 18. Jahrhunderts werden die ersten Sorten erwähnt. Heute kennt man über 1.000 Sorten. Sie werden vor allem in Europa und Nord- und Südamerika angebaut.
Die Wildart ist eine Waldpionierpflanze, das heißt, sie wächst in Waldlichtungen, aber auch an Waldrändern und auf Schuttplätzen.
Die Vermehrung von Himbeeren erfolgt durch Ausläufer oder Wurzelschnittlinge. Himbeeren können im Herbst oder im zeitigen Frühjahr in noch laublosem Zustand gepflanzt werden. Als Standort eignen sich alle sonnigen Lagen mit humusreichem, lockerem und tiefgründigem Boden. Alternativ können Himbeeren auch auf Erdwällen kultiviert werden. Auf staunassen Böden muss unbedingt eine Drainage verlegt werden. Der Anbau in Spätfrostlagen ist zu vermeiden, da die Jungtriebe frostempfindlich sind. Als Pflanzgut werden verholzte Ruten und Topfpflanzen angeboten. Der Pflanzabstand in der Reihe beträgt 30-40 cm, der Reihenabstand je nach Pflanzsystem 2,50-3,50 m.
Man unterscheidet Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Bei den Sommerhimbeeren werden die abgetragenen Ruten nach der Ernte dicht über dem Boden abgeschnitten und 8-12 gesunde Jungruten pro laufendem Meter belassen. Diese fruchten dann im folgenden Jahr. Die Ernte ist von Juni bis Anfang Juli. Die Erziehung erfolgt als aufrechte Hecke oder als bewegliches V-System. Vorteil des V-Systems ist die bessere Beerntbarkeit (Ertragszone außen, Jungruten innen). Bei den Herbsthimbeeren werden alle Ruten nach der Ernte abgeschnitten. Im Juni werden die nachgewachsenen Jungruten auf etwa 20 Ruten pro laufendem Meter ausgedünnt. Die Ernte beginnt Mitte August und endet beim ersten Frost.
2016 betrug die Welternte 795.000 Tonnen. Das Land mit der größten Himbeerproduktion der Welt war Russland, das 20,7 % der weltweiten Ernte produzierte. Europa war für etwa 62,7 % der Welternte verantwortlich.
Die Früchte sind recht weich und verderben schnell. Sie sollten deshalb spätestens zwei Tage nach der Ernte beim Endverbraucher sein. Verbreitet sind der direkte Absatz und die Belieferung des Großhandels. Sie werden nur in 250 g-Schalen angeboten.
Sie werden als Frischware zum Verzehr oder als Rohware für die Verarbeitungsindustrie (Konfitüre, Säfte) verwendet. Sie eignen sich auch zum Tieffrieren. Wenn sie nicht direkt verzehrt werden, lassen sie sich frisch für Obst- oder auch herzhafte Salate verwenden, als Kuchenbelag oder für Desserts. Man kann sie zu Konfitüre, Sirup, Saft oder Roter Grütze verarbeiten und sie schmecken ganz hervorragend als Mus. Wer mag, kann eine Reihe von industriell hergestellten Produkten probieren, unter anderem Likör, Wein und Essig.
(u. a. KOB)
Sammelbezeichnung für kleinfrüchtiges Spelzgetreide mit 10–12 Gattungen. Sie gehören zur Familie der Süßgräser (Poaceae). Hirse diente bereits vor 8000 Jahren dazu, ungesäuertes Fladenbrot herzustellen. In China wird Rispenhirse seit mindestens 4000 Jahren landwirtschaftlich genutzt. Die Rispenhirse oder Echte Hirse (Panicum miliaceum) wurde früher auch in Europa als Nahrungsmittel angebaut.
Alle Hirsearten können nach der Beschaffenheit der Körner in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden, die Sorghumhirsen und die Millethirsen.
Sorghumhirsen (Sorghum) besitzen deutlich größere Körner und damit auch höhere Hektarerträge (14–17 dt/ha).
Zu den wichtigsten Hirsearten der Gattung Sorghum zählt die Mohrenhirse (Sorghum bicolor). Das einjährige Gras kann eine Höhe von 5 m erreichen. In ihrem Wuchs erinnert die Mohrenhirse stark an Mais. Die markerfüllten Halme tragen bandförmige zweizeilige Blätter. An den terminalen Enden der Pflanzen sitzen aufrechte, lockere Rispen von 10–60 cm Länge, deren Ästchen jeweils 2 Ährchen tragen. Die unbespelzten Körner zählen zu den Karyopsen und haben einen Durchmesser von 4-8 mm. Je nach der Sorte können sie weiß, gelb oder rot sein.
Die Mohrenhirse ist frostempfindlich, licht- und wärmebedürftig. Mit ihren bescheidenen Wasseransprüchen ist sie äußerst dürreresistent. Bei starker Trockenheit kann sie unter Wachstumsstillstand in eine Trockenstarre übergehen, aus der sie erst nach einsetzenden Regenfällen erwacht. Zu den verschiedenen agronomischen Typen der Mohrenhirse zählen Sudangrastyp, Zuckertyp, Fasertyp, Futtertyp und Körnertyp.
Die Mohrenhirse ist ernährungsphysiologisch äußerst wertvoll. Sie besteht zu 60-75 % aus Kohlenhydraten, zu 8-13 % aus Proteinen von guter biologischer Wertigkeit und zu 4-6 % aus Fett. Eines der Ziele der Forschung ist es, den Nährstoffgehalt der Mohrenhirse in Hinblick auf ihren Gehalt an Vitamin A, Zink, Eisen und essentielle Aminosäure weiter zu verbessern.
Ursprünglich stammt die Mohrenhirse aus Äquatorialafrika. Afrikanische Sklaven brachten sie Anfang des 17. Jahrhunderts in die USA. Heute wird sie in allen warmen, tropischen und subtropischen Gebieten der Erde angebaut.
In Entwicklungsländern ist die Mohrenhirse ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Die Körner sind in ihrer Verwendung ähnlich dem Reis. Aus dem ganzen Korn werden Brei, Grütze und Fladen hergestellt und ebenso Bier gebraut. Zum Backen von Brot ist Hirse wenig geeignet.
Die Mohrenhirse gilt aufgrund der großen und kohlenhydratreichen Biomasse als aussichtsreiche Energiepflanze zur Biogaserzeugung, vor allem in trockenen Lagen.
Daneben wird Hirse vom Fasertyp traditionelle zur Herstellung von Besen, zur Nutzung als Baumaterial oder zur Papierherstellung angebaut. Blätter und Stroh der Mohrenhirse dienen als Viehfutter.
Die Zuckerhirse wird zur Herstellung von Melasse, Grünfutter und Silage verwendet. In Entwicklungsländern dient sie ebenfalls als Brennstoff und Baumaterial.
Insbesondere in den Industrienationen gewinnt die Hirse zunehmend an Bedeutung als nachwachsende Energie- und Rohstoffpflanze. In den USA wird Zuckerhirse verstärkt zur Herstellung von Bioethanol genutzt, wobei der Zucker zur Ethanolherstellung aus den Sprossachsen der Pflanze gewonnen wird. In Deutschland wird Zuckerhirse versuchsweise zur Verwendung als Biogassubstrat angebaut, da sich ähnliche Methanausbeuten wie bei der Vergärung von Maissilage erzielen lassen.
Die Faserhirse, die auf einen besonders hohen Gehalt an Cellulose aufweist, wird ebenfalls zur energetischen Nutzung angebaut.
Millethirsen (Paniceae, auch Echte Hirsen oder Kleine Hirsen genannt). Zu diesen gehören die meisten Gattungen, z.B. Rispenhirse (Panicum), Kolbenhirse (Setaria), Perlhirse (Pennisetum), Fingerhirse (Eleusine) und Teff (Eragrostis). Die Körner dieser Gattungen sind recht klein, die Erträge entsprechend gering (ca. 7–9 dt/ha). Der Begriff „Millet“ wird überwiegend in der englischen und französischen Sprache verwendet. In Afrika spricht man häufig auch von Milo oder Milocorn.
Weltweit wurden im Jahr 2013 laut FAO insgesamt 91,3 Mio. t Hirse produziert. Davon entfielen 61,4 Mio. t auf Sorghumhirsen und 29,9 Mio. t auf Millethirsen. Die produzierte Hirse wurde hauptsächlich zu Breinahrung und Futtermittel verarbeitet. Der Hektarertrag ist mit durchschnittlich 11,8 dt/ha (Millet: 9,1 dt/ha, Sorghum: 14,6 dt/ha) von allen Getreidearten der geringste. Dies ist einer der Gründe, weshalb der wesentlich ertragreichere Mais in den traditionellen Hirseanbaugebieten immer populärer wird. Allerdings hat Hirse gegenüber Mais den großen Vorteil, dass die Ernte selbst bei sehr schlechtem Wetter fast nie komplett ausfällt.
Weitere Informationen:
Hochertragssorten (engl. high-yielding varieties, HYVs) von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen zeichnen sich im Gegensatz zu den konventionellen Sorten in der Regel durch eine Kombination der folgenden Merkmale aus
Die wichtigsten HYVs finden sich bei Weizen, Mais, Soja, Reis, Kartoffeln und Baumwolle. Sie werden in großem Umfang in kommerziellen Betrieben und Plantagen eingesetzt.
HYVs wurden in den 1960er Jahren populär und spielten eine wichtige Rolle in der Grünen Revolution, obwohl ihre ursprünglichen Wurzeln älter sein können. HYVs werden im Bereich der Biotechnologie entwickelt.
Der Begriff steht zum einen für einen biogeographischen Landschaftstyp mit ausgeprägtem Feuchtgebietscharakter und entsprechender Vegetation. Zum anderen bezeichnet der Begriff in der Bodenkunde einen Bodentyp.
Hochmoore, auch ombrotrophe Moore ((von griech. ómbros = Regen) oder Regenmoore genannt (in Oberbayern auch Filze), sind mineralsalzarme, saure und nasse Lebensräume mit einer an diese extremen Bedingungen angepassten Flora und Fauna. Hochmoore werden im Gegensatz zu Niedermooren ausschließlich aus Niederschlägen (Ombrotrophie) und durch aus der Luft eingetragene Mineralsalze versorgt und stellen damit einen speziellen hydrologischen, ökologischen und entwicklungsgeschichtlichen Moortyp dar.

Quelle: Heinrich Böll Stiftung (2023)
Die Torfbodenschichten haben keine Verbindung zu Grundwasservorkommen oder Oberflächengewässern, so dass kein Ionenaustausch mit dem Mineralboden stattfindet. Dennoch zeichnen sie sich durch einen fast stets vorhandenen, regenbedingten Wasserüberschuss aus. Man könnte sie mit vollgesogenen Schwämmen vergleichen (bis zu 90% Wasser), die erhaben in der Landschaft liegen. Daher rührt der Begriff Hochmoor, der sich strenggenommen nur auf die klassischen uhrglasförmig aufgewölbten Moore Nordwestdeutschlands bezieht.
Hochmoore sind in der Regel nährstoffarm (oligotroph) und vergleichsweise bodensauer, mit pH-Werten zwischen 3 und 4,8. Die Pflanzengesellschaften der Hochmoore müssen entsprechend hoch spezialisiert sein. Torfmoose (Sphagnum) sind an dieses saure Milieu angepasst und können mehr als das 30-fache ihrer Trockenmasse an Wasser speichern, worüber sie Ihren geringen Nährstoffbedarf decken können. Sie sind maßgeblich an der Jahrhunderte bis Jahrtausende währenden Torfbildung beteiligt, wodurch Hochmoore jährlich bis zu 1 mm in die Höhe wachsen. Aber auch Heidekrautgewächse, Wollgräser, Seggen, Rasenbinsen und Sonnentaugewächse - letztere decken ihren Nährstoffbedarf über den Fang kleiner Insekten - können unter den extremen Standorteigenschaften der Hochmoore gedeihen. Gut ausgeprägte Hochmoore sind in der Regel - zumindest in ihrem Zentrum - frei von Bäumen oder starkwüchsigen Gehölzen.
Das Normhochmoor besitzt nach der Deutschen Bodensystematik (AG Boden 2005) folgendes Profil: hHw/(hHr/)(uHr/)(nHr/)(IIfF/).
Erd-Hochmoor aus entwässerten Hochmoortorfen bei Lenningen-Schopfloch (BW)
Die sehr geringe Wasserdurchlässigkeit der Vulkantuffe im Schopflocher Moor nördlich von Lenningen-Schopfloch ( (Lkr. Esslingen) bewirkte in Verbindung mit den hohen Niederschlägen (über 1100 mm) die Entstehung des einzigen Hochmoors der Schwäbischen Alb. Der Torf war ursprünglich bis zu 4 m mächtig. Durch den ehemaligen Torfabbau ist er aber inzwischen deutlich dezimiert und die Mooroberfläche sehr stark gestört. Seit 1931 steht das Schopflocher Moor unter Naturschutz. Im Randbereich, wo der Torf auskeilt bzw. vollständig entfernt wurde, sind Stagnogleye, Pseudogleye und entsprechende Übergänge zu Moorböden verbreitet.
Link zum Symbolschlüssel Bodenkunde Baden-Württemberg
Quelle: LGRBwissen
Nach der Bildung eines Niedermoors kann sich die Mooroberfläche unter günstigen Standortbedingungen durch weiteres Wachstum der Pflanzen und Abkoppelung vom Grundwasser über ein Übergangsmoor zum Hochmoor entwickeln. Der pH-Wert des Moorwassers – man könnte auch Bodenwasser sagen – ist nun sehr niedrig (+/- 3,5, oft < pH 3,5) sowie nährstoff- und sauerstoffarm. Der Torfkörper des Hoch- oder Regenmoores, das nur noch vom Niederschlag „ernährt“ wird, besitzt nun eine uhrglasförmige (konvexe) Oberfläche.
Bei weiterem Wachstum verschwindet der Bruchwald und schließlich bilden vor allem Torfmoose, die zahlreichen Sphagnum-Arten sowie Wollgräser (Eriophorum spec.), Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), Binsen (Juncus spec.) und andere Hochmoorpflanzen den gewölbten Torfkörper des Hochmoores.
Hochmoore wurden in den vergangenen Jahrhunderten vielfach durch mehr oder minder planlosen Torfstich zur Gewinnung von Brenntorf oder durch extensive Moorbrandwirtschaft genutzt.
Lebende und noch wachsende Hochmoore gibt es heute kaum noch. Die letzten großen Hochmoorgebiete befinden sich in Westsibirien und Kanada.
Die größte Gefährdung der Regenmoore geht vom Torfabbau aus. Insbesondere der Abbau von Torf zur Herstellung von Gartenerde hat heute einen hohen Stellenwert eingenommen. Die Torfvorräte Mitteleuropas sind weitgehend aufgebraucht. Deshalb wird immer mehr Torf aus Westsibirien und Kanada importiert und gefährdet die dortigen meist noch großflächigen und weitgehend intakten Regenmoore.
Die Gefährdung von Regenmooren durch die Moorkultivierung, das heißt die Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen, hat heute nur noch eine geringe Bedeutung. Intensivgrünland und Acker auf Regenmoorstandorten erfordern aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Torfes (Sackung und Schrumpfung) mehrmalige Bearbeitungen sowie intensive Düngungen und sind daher nicht rentabel.
Indirekte Einflüsse wie Mineralsalzeinträge durch Dünger aus der Landwirtschaft, Pestizide, sowie Nährstoff-, Mineralsalz- und schadstoffbelastetes Regenwasser aus häuslichen und industriellen Verbrennungsanlagen sind von größerer Bedeutung. Dadurch können noch intakte Regenmoore in ihrem hochmoortypischen Stoffhaushalt empfindlich gestört werden.
Die Wiedervernässung trockengelegter Hochmoore ist der erste, zentrale Schritt einer Renaturierung. Wichtig und von Bedeutung ist bei der Hochmoor-Renaturierung die Vernässung mit mineralsalzarmem Wasser, also Regenwasser. Dieses erreicht man, indem man zuerst alte Entwässerungsgräben mit Hilfe von Dämmen wieder verschließt. Weiterhin müssen Gehölze auf der Fläche beseitigt werden, denn sie nehmen den Mooren das Licht, tragen zur Verdunstung und damit zum Verlust großer Mengen an Wasser bei. Eine Wiedervernässung dauert in der Regel einige Jahre. Gleichzeitig führt der steigende Wasserspiegel zu einem Absterben der unerwünschten Vegetation. Über einige Jahrzehnte hinweg soll es dann zur Wiederherstellung naturnaher Bedingungen kommen. Hochmoorpflanzen sollen sich wieder ausbreiten. Langfristiges Ziel, das heißt in Jahrhunderten, ist schließlich die vollständige Regeneration. Die Hochmoor-Regeneration ist dann erreicht, wenn die vernässte Moorfläche wieder zu einem lebenden und torfbildenden also wachsenden Hochmoor geworden ist.
Weitere Informationen:
Unter Hochwald versteht man eine Waldform, bei der die einzelnen Stämme aus Kernwüchsen entstehen. Das heißt, Bäume sind aus einem Samen gewachsen. Diese wachsen zu hohen Individuen heran, deren Form und Vitalität den Bäumen in Stockausschlagswäldern (Niederwald) tendenziell überlegen ist.
Diese Forstbetriebsart, sie dient vor allem der Produktion von Stammholz und bedingt damit eine lange Umtriebszeit (etwa 80 Jahre bei Nadelwald, bis 250 Jahre bei Eiche). Der überwiegende Teil der heutigen Forstflächen wurde seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Hochwald überführt. Die Bezeichnung beschreibt das "Hochwachsen" der Waldbäume in einem Bestand aus Kernwüchsen, also aus Samen oder Setzlingen. Wurde der Bestand auf einer Fläche, z.B. nach einem Kahlschlag, zur gleichen Zeit begründet, entsteht ein Bestand aus gleichaltrigen Bäumen, der Altersklassenwald, u.U. aus nur einer Baumart. Im Plenterwald stehen dagegen Bäume aller Entwicklungsstufen auf kleinster Fläche nebeneinander, da hier gezielt nur diejenigen Bäume entnommen werden, die einen bestimmten Zieldurchmesser erreicht haben.
Der Hochwald ist heute die am weitesten verbreitete Waldform, die sich unter anderem durch große Holzvorräte auszeichnet.
Der Begriff 'Hochwasser' bezeichnet den Zustand von Gewässern, bei dem ihr Wasserstand deutlich über dem Pegelstand ihres Mittelwassers liegt (z.B. mittlerer jährlicher Wasserstand). Landläufig verbindet sich mit Hochwasser eine Gefährdung von Menschen und Gütern durch Überschwemmungen.
Hochwässer werden durch Niederschläge, Schnee- und Eisschmelze, Eisstau und Bruch einer Eisbarriere oder durch eine Kombination dieser Faktoren ausgelöst.
Hochwässer können auch durch eine Kombination einer oder mehrerer dieser Faktoren ausgelöst werden, was zu einer Verschärfung des Hochwasserabflusses führen kann. Ob ein erhöhter Wasserstand landläufig als Hochwasser empfunden wird, ist ganz unterschiedlich. Der Schiffer beispielsweise spricht von einem Hochwasser, wenn bestimmte Wasserstände, die an den Flußufern mit deutlich sichtbaren Hochwassermarken angegeben sind, erreicht oder überschritten werden. Die Schifffahrt muß dann eingestellt werden, weil die durch die Schifffahrt ausgelöste Wellentätigkeit zu Schäden im Uferbereich führen kann oder weil den Schiffen Brückendurchfahrten nicht mehr möglich sind. Der am Fluss lebende Anwohner empfindet dagegen den Abfluss dann als Hochwasser, wenn dadurch sein Haus gefährdet wird.
Bei den Niederschlagsereignissen, die Hochwässer auslösen, müssen konvektive Schauer- und Gewitterregen genannt werden, bei denen sich an der Kaltfront kalte Luft unter die Warmluft schiebt. Der hierdurch erzwungene, rasche und steile Aufstieg der Warmluft führt zur Entstehung hoher Wolkentürme, die ergiebigen Niederschlag auslösen. Ebenfalls hohe und räumlich begrenzte Niederschläge werden durch die Thermik der sonnenerwärmten Luftmassen ausgelöst. In einem großen Einzugsgebiet wirken sich solche Niederschläge kaum an einem flußabwärts gelegenen Pegel aus. In betroffenen kleinen Gebieten können sich jedoch regelrechte Sturzfluten entwickeln, was lokal zu Überschwemmungen führen kann.
An Küsten wird unter 'Hochwasser' auch der höchste Wasserstand während einer Tide (Gezeiten) verstanden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung für die landwirtschaftlichen Wohn- und Wirtschaftsbauten (Bergeraum, Ställe), soweit sie einen landwirtschaftlichen Betriebbilden. Dabei ist belanglos, ob sie aus mehreren Gebäuden (Mehrbauhof, Sammelhof) bestehen oder ob alle Funktionen unter einem Dach (Einheitshof, Einhaus) vereint sind. Gelegentlich wird der Begriff Gehöft synonym verwendet.
(s. a. Hofformen)
Eher historisch zu verstehender Typ des Vollerwerbslandwirts, der bei entsprechender Bodenausstattung ein angemessenes Einkommen pro Arbeitskraft erwirtschaften kann. Zu seinen wesentlichen Merkmalen zählen die Selbständigkeit bei der Bewirtschaftung und daneben die geschlossene Hofübergabe im Erbfall sowie die Zuordnung zur bäuerlichen Mittelschicht. Ähnlich wie der Vollbauer zeichnet er sich durch eine große Traditionsgebundenheit aus, wobei dieser Wesenszug sich in moderner Zeit hin zu marktorientierten, kapitalistisch-unternehmerischen Verhaltensweisen wandelt. Regionale und historische Varianten zum Hofbauern sind z.B. die Begriffe Altbauer, Anspänner, Vollspänner, Pferdner, Bonde, Vollerbe, Hufner und Vollhüfner.
Auch Hofsterben; der Begriff bezeichnet eine durch strukturelle Ursachen bedingte, massenhafte Aufgabe von (zumeist kleineren) landwirtschaftlichen Betrieben. Eine häufige Ursache ist mangelnde Wirtschaftlichkeit (Rentabilität). So müssen landwirtschaftliche Betriebe beispielsweise aufgeben, weil sie im Vergleich zu anderen Wettbewerbern eine geringere Produktivität bei der Herstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufweisen. Dann laufen sie Gefahr, dass der Preis, der beim Verkauf der Erzeugnisse erzielt wird, die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion nicht deckt. Weitere Ursachen sind alternative Erwerbsmöglichkeiten, die u. a. ein höheres und sichereres Einkommen versprechen. Zum Problem wird heute vielfach auch die fehlende Hofnachfolge, also die fehlende Bereitschaft der nachfolgenden Generation, den Hof zu übernehmen.
Die Zahl der Betriebe in Deutschland ist seit Mitte der 1990er-Jahre um die Hälfte geschrumpft. Ein Drittel der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gingen verloren.
Eine Entwicklung, von der auch alle übrigen EU-Länder betroffen sind: In einem Zeitraum von nur zehn Jahren, zwischen 2003 und 2013, sind EU-weit ein Drittel aller Bauernhöfe verschwunden. Fast alle dieser Betriebe bewirtschafteten weniger als zehn Hektar und waren damit zu klein zum Überleben: Ihre Erträge deckten – wegen der anhaltend niedrigen Lebensmittelpreise – kaum die Kosten der Produktion.
Ihre Flächen übernahmen meist größere Betriebe. Die Hälfte des kompletten Agrarlandes der EU wird heute von drei Prozent aller Betriebe bewirtschaftet. Die Folgen: Verlust von Arbeitsplätzen, intensive Produktionsmethoden, weniger Produkt- und Artenvielfalt auf dem Acker.
Die umfangreichen Agrarsubventionen konnten die Aufgabe von Betrieben in der Vergangenheit nicht aufhalten. Im Gegenteil, der Subventionspolitik der EU wird von Kritikern eine Mitschuld am Höfesterben gegeben: Es seien nicht zuletzt die Direktzahlungen an die Landwirte aus der sogenannten ersten Säule. 70 Prozent dieser Gelder sind direkt an Flächen gekoppelt. Wer viel hat, bekommt demnach viel. Das steigert den Anreiz, zu wachsen – also etwa Flächen von kleineren Betrieben aufzukaufen, die aufgeben mussten. Zwar erhalten seit der letzten Reform der GAP im Jahr 2013 auch kleinere Betriebe mehr Geld. Doch reiche das nicht aus, um das Höfesterben aufzuhalten. (Agraratlas 2019)
In geschichtlicher Hinsicht ist das heutige Höfesterben insbesondere eine Folge der agrartechnischen Revolution im 19. und 20. Jahrhundert und der Industrialisierung der Landwirtschaft während der letzten Jahrzehnte. Diese Entwicklungen waren von Mechanisierung (durch Innovationen in der Landtechnik) und Chemisierung (etwa durch Einführung synthetischen Stickstoff-Düngers) geprägt. Die sich aus ihnen ergebenden Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern, bestimmten fortan den Wettbewerb und die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe.
Höfesterben verändert die Agrarstruktur eines Gebiets. Im Weiteren ergeben sich Auswirkungen auf die Sozialstruktur (Sozialbrache) und den Naturhaushalt sowie auf das Orts- und Landschaftsbild.
(s. a. Wachsen oder Weichen)
Weitere Informationen:
Durch Größe, architektonische Eigenheiten und Baumaterialien manifestierte Ausdrucksformen von Kräften und Einflussgrößen auf die Gestalt landwirtschaftlicher Anwesen, zu deren wesentlichsten folgende Punkte gehören:
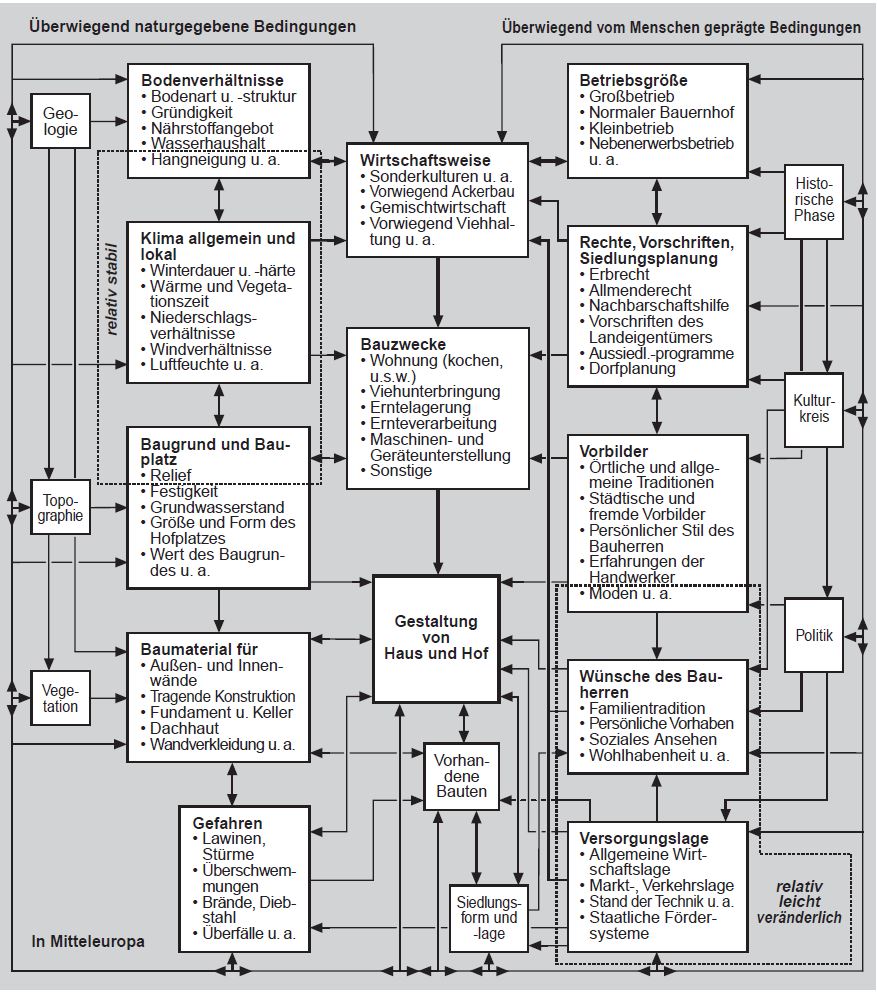
Quelle: Ellenberg 1990, verändert
Für Mitteleuropa allein werden zwischen 16 (Schröder, 1974) und 42 (Gebhard, 1982) Formtypen unterschieden. Entsprechend groß ist auch eine beklagenswerte Definitionsvielfalt mit unzähligen Überschneidungen.
Als erste Annäherung: Von Einheitshaus / Einfirsthof / Einbauhaus / Einhaus / -hof spricht man, wenn alle Funktionen unter einem Dach vereinigt sind, im Falle einer Trennung von Mehrbauhof oder Gehöft.
Einheitshäuser | |
|---|---|
| Einheitshäuser mit Längsteilung (Aufteilung innen parallel zur Längsseite) Friesische Haustypen: | |
| Eiderstädter Haubarg | in Marschen der Nordsee; größte Bauernhausform; "Vierkant" mit vier Hauptpfosten im Zentrum für Heuspeicherung; Dach bis 15 m hoch; tief herabreichend, ursprünglich Strohbedeckung; Vierkant umgeben von Ställen, Kammern und Abstellräumen unter gleichem Dach. Wohnteil z.T. erst später angefügt; Fehlen von Tenne und Getreidespeicher |
| Friesisches Gulfhaus | eng mit Haubarg verwandt; durch Anfügen weiterer Vierkante gestreckter als Haubarg; in der Mitte der vom EG bis zum Dach reichende Gulf für Heu-, aber auch Getreideernte; an Schmalseiten und z.T. Hinterseite Ställe; vorn angefügt Wohnteile mit Diele, Küche und Stuben. Bei beiden Typen relativ geringe Holzverwendung. |
| Niederdeutsches Einhaus (ehemals Niedersächsisches Haus) | Verbreitung von Küste bis Mittelgebirgsrand (Kernraum Lüneburger Heide, Oldenburg, Unterweser); Ausdehnung mit Kolonisation längs der Ostseeküste |
| Längsdielenhaus (Langhaus) | vier tragende Eckpfosten und giebelseitige große Einfahrt; mittlere Diele als Dreschtenne; seitlich Stände für Vieh; darüber Speicherraum; Verbreiterungen durch Seitenschiffe (Kübbungen) unter herabgezogenem Dach (Dreihallenhaus); in Kübbungen Ställe, Kammern, Vorratsräume; an hinterer Schmalseite Fleet (Querdiele) mit ursprünglich offener Feuerstelle; später Einbau von Wohnstuben und eigenem Wohnteil an Schmalseiten |
| Vierständerhaus | Verbreiterung und Verstärkung des Längsdielenhauses mit vier Ständern an Schmalseiten, besonders in Getreidebaugebieten zur Vergrößerung des Speicherraums |
| Ostelbische Formen: | |
| Längsdielenhaus | in Brandenburg und Pommern mit schmaler Mitteldiele, seitlichen Wohn- und Stallräumen, im Dachgeschoß Erntespeicher; kleiner als Niederdeutsches Einhaus |
| Laubenhaus | in Hinterpommern, Ostpreußen, Schlesien, Wartheland |
| Einheitshäuser mit Querteilung (Innenaufteilung parallel zur Querseite): | |
| Oberdeutsches Einhaus | Aufschließung von der Trauf- nicht von der Giebelseite; Wohnteil, Scheune und Stallungen nebeneinander unter einem Dach; Speicherraum z.T. auch im Dachgeschoß; Wohnteile mit Querflur, Trennung von Küche und Stube, z.T. auch zweigeschossig; Steinmaterial bei Wohnung und Stall, Scheune und Heuboden z.T. aus Holz und Fachwerk; früher Strohdach, in Gebirgsgebieten Holzschindeln (Landerndach); Verbreitung: dt. Alpenvorland, Schwäbische Alb, westliches Rheinisches Schiefergebirge |
| Wohn-Stall-Haus (Unterländer, gestelztes Haus) | auch hier Vereinigung von Wohnteil, Stall und Scheune unter einem Dach, jedoch mit Wohnung über dem Stall; letzterer mit Steinwänden, darüber z.T. Fachwerkgerüst (Stelzung im eigentlichen Sinn); meist kleinbäuerlicher Typ; Verbreitung im mitteldeutschen Gebirge von Saargebiet bis Hessisches Bergland, bes. im Neckarland, auch Bodenseegebiet, vertreten auch im Mittelmeerraum und in den Westalpen; bes. in Gebieten der Realteilung und des Weinbaus |
| Schwarzwaldhaus | mit Wohnteil an Frontseite, dahinter (zum Hang) Ställe, darüber durch ganzes Haus Speicherraum unter tief herabgezogenem Dach; manchmal auch Wohnteil und Scheune (Heuboden) im Obergeschoß über dem Stall im Untergeschoß; Aufschließung von Traufseite; Unterteil aus Stein, darüber Holzaufbau, Holzveranden an Wohnteil; bei Anbau an Berg Hocheinfahrt in Scheuer; verschiedene Unterarten (Heidenhaus, Kinzig- und Gutachtalhaus) |
| Ostbayerischer Langbau | Mehrstöckiger Bau mit vorderem Wohnteil, dahinter Tenne und Ställe (unten) und Scheune (oben). Steinsockel und Holzaufbau, umlaufende Holzgalerien; Eingang an Giebelseite; relativ flaches Dach; ursprünglich Schindeln mit Steinbeschwerung; Verbreitung in Oberbayern und Ostalpen (bes. Salzburg, Tirol) |
| Lothringer Haus | mit Querteilung und traufseitiger Aufschließung; enge, oft lückenlose Aufreihung an Dorfstraßen, flach geneigtes Dach |
Mehrbauhöfe (Gehöfte) | |
| Ungeregelte Form: | |
| Haufen- oder Streuhof | Trennung der Gebäude nach Funktionen mit Wohn-, Ausgedinghaus, Speicher, Ställen, Scheune, Backofen u.a.; manchmal 20 und mehr Gebäude; Altform! Vorkommen z.T. noch in Nordeuropa, den Alpen, SO-Europa, Mitteleuropa; auch der Zwiehof (Paarhof) der Alpen wird dazugerechnet. |
| Geregelte Form: | |
| Mitteldeutsches Gehöft (ehemals Fränkisches Gehöft) | regelmäßige Anordnung der Wohn- und Wirtschaftsgebäude um den Hof; weitest verbreitete Form von Ober- und Mittelrheingebiet bis östlich der Weichsel, auch in Nordfrankreich, Niederösterreich und Burgenland; bes. häufig in fruchtbaren Getreidebaugebieten mit vielseitiger Wirtschaft |
| Untertypen nach Anordnung der Gebäude: | |
| Streckhof | hintereinandergeschaltete Gebäudeteile in einer Linie |
| Zweireiher | zwei parallel stehende Gebäudereihen |
| Zweiseithof | mit rechtwinklig stehenden Gehöftteilen, bei Verbindung der Teile mit gleicher Firsthöhe Zweikanthof; Bezeichnung auch als Haken- oder Winkelhof |
| Dreiseithof | mit drei Gebäudeteilen um den Hofplatz; Vorderseite oft durch Mauer oder Zaun mit Tor abgeschlossen; sehr starke Verbreitung im mittleren Deutschland, Regelform in den deutschen Siedlungsgebieten Siebenbürgens; Dreikanthof bei gleichlaufender Firstlinie |
| Vierseithof | von Gebäuden allseitig umschlossen; Vierkanter bei gleichlaufender Firstlinie |
| Hofhaus des Orients sowie das Patiohaus der Mittelmeergebiete und spanisch bzw. portugiesisch kolonisierter Überseegebiete | |
| speziell sozial bestimmte Typen: | |
| Seldner- und Kötterhaus | in Dorfrandgebieten mit meist kleinen Wohn- und Wirtschaftsräumen, häufig nur Erdgeschoss |
| Gutshöfe und Herrenhäuser | umfangreiche Gebäude, angeschlossene Verarbeitungsbetriebe, Landarbeiterhäuser, Parks |
Viele Hof- und Gehöfttypen sind mit bestimmten Betriebsgrößen verbunden und entstanden, wie z. B. die Einhausregionen Württembergs mit Betriebsverkleinerungen im Rahmen der Realteilung. Auch physische Faktoren wie Boden- und Klimaverhältnisse, Vegetation, Gestein und Baugrund hatten Einfluss auf die Hofgestaltung. Weitere Faktoren sind u. a. Wirtschaftsweise, Anbauprodukte, Erwerbscharakter, kulturelle Leitbilder, Agrarstruktur und rechtliche Normen. Seit Jahrzehnten haben auch Faktoren wie fortschreitende Technisierung, Erfolge in der Pflanzen- und Tierzucht, agrarpolitische und wirtschaftliche Zwänge starke Auswirkungen auf Gestalt und Nutzung traditioneller wie auch neuer Höfe.
Zu diesen Vorgängen gehören:

Quelle: Haversath, J.-B. und Ratusny, A. (2002): Bauernhaustypen. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland/5. – Dörfer und Städte / Institut für Länderkunde, Leipzig (Hrsg.). Mitherausgegeben von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2002, S. 48f.
Die Hofform zusammen mit anderen gewachsenen Formelementen der ländlichen Kulturlandschaft verleihen dieser ihre unverwechselbare Identität. Ihre weitmögliche Bewahrung ermöglicht es den Bewohnern, sich mit ihrem Wohnort zu identifizieren, Heimatgefühl zu entwickeln.
Moderne, neuangelegte Gehöfte der Industrieländer entziehen sich überwiegend einer Klassifizierung. Es sind i.d.R. nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten durchplante Anlagen, die Arbeitswege kurzhalten und weitgehende Mechanisierung erlauben. Es erfolgt allgemein eine Nachahmung städtischer Bauformen und die Verwendung ortsfremder Baustoffe mit dem Ergebnis eines oft disharmonischen Bildes.
Weitere Informationen:
Auch Hofstätte; die Fläche einer Hofstelle, welche die Gebäude mit Hausgärten (Bauerngärten) und jene Grundstücksteile umfasst, die für hofgebundenes Arbeiten, Kleintierhaltung und Lagerung (z.B. Stallmist, Brennholz) dienen. Sie gilt als die eigentliche Substanz einer ländlichen Siedlung.
Hohe begehbare Schutzabdeckungen sind feste oder bewegliche Überdachungen, die Kulturen vor Witterungseinflüssen schützen und gleichzeitig begehbar sind. Beispiele sind Gewächshäuser, Folientunnel oder vergleichbare Konstruktionen, die aus Glas oder festem Kunststoff bestehen. Schutz- und Schattennetze mit sehr dichtem Gewebe und Beschattungsgrad von mindestens 80 Prozent zählen ebenfalls dazu - sofern begehbar.
Diese Abdeckungen werden häufig im Gemüse- und Beerenanbau eingesetzt, um die Anbauzeit zu verlängern oder bestimmte Kulturen auch außerhalb der üblichen Saison anzubauen.
Beispielsweise wurden 2024 rund 6.640 Tonnen Strauchbeeren 2024 aus Kultivierung unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen geerntet. Etwa 5.300 Tonnen davon waren Himbeeren. Diese Strauchbeerenart dominiert den geschützten Anbau mit einem Flächenanteil von 79 Prozent. Durch den Anbau unter Schutzabdeckungen konnte hier, verglichen mit anderen Strauchbeerenarten, eine bessere Ernte erzielt werden. Himbeeren reagieren besonders empfindlich auf Witterungseinflüsse. Daher lohnt sich gerade bei dieser Frucht der im Vergleich kostenintensivere Anbau unter Schutzabdeckungen. In den vergangenen zehn Jahre lässt sich bei Himbeeren ein klarer Trend, weg vom Freilandanbau und hin zur Kultivierung in hohen begehbaren Schutzabdeckungen, beobachten. (BLE)
Auch auf Baumschulflächen (Jungpflanzenanzucht) werden hohe begehbare Schutzabdeckungen eingesetzt.
Die agronomische Höhengrenze ist ihrem Wesen nach eine Kältegrenze (in die sie in hohen Breiten allmählich übergeht); entsprechend nähern sich polwärts die unterschiedlichen Höhengrenzen immer mehr dem Meeresspiegelniveau. Die Höhengrenze ist im Vergleich zu Polar- und Trockengrenzen nur fragmentarisch ausgebildet und scheidet auch nur kleine Gebiete aus dem Agrarraum der Erde aus. Sie spiegelt als komplexe Erscheinung neben dem Wärmemangel auch die Merkmale der jeweiligen Klimazone, wie z.B. hygrische Jahreszeiten und hohe Einstrahlung in den Rand- und Subtropen oder die thermischen Jahreszeiten in den höheren Breiten.
Der Verlauf der Höhengrenze kann kleinräumig durch Gesteinsart, Boden, Hangneigung, Exposition zur Sonne und zur Hauptwindrichtung erheblich verändert werden. Auch können sich Risikofaktoren wie Lawinen, Muren, Hangrutschungen, verstärkte Bodenerosion u.ä. modifizierend auswirken. Das Verteilungsbild der Kulturpflanzen in ihrer Gliederung nach Höhenstufen ist jedoch nicht so eindeutig wie die Differenzierung nach Kältegrenzen; z.B. Tee und Sisal haben enge Polargrenzen, aber weitgespannte Höhengrenzen; Rüben, Sojabohne und Erdnuss breiten sich polwärts stark aus, meiden aber die Höhenlagen.
Die größten Höhen erreicht die agronomische Höhengrenze in den trockenen Randtropen und Subtropen sowie im Inneren großer Gebirge (Bolivien: Kartoffelanbau bis 4.300 m, Tibet: Gerste bis 4.750 m). Weideflächen finden sich in den meisten Gebirgen noch oberhalb der agronomischen Höhengrenze.
(s. a. Landnutzung, Grenzen der, Anbaugrenzen)
Landwirtschaftliche Nutzung hochgelegener Gebiete und Gebirgslagen, in denen durch Klima, Relief und Böden Einschränkungen gegeben sind. Der Anteil von Ödland und Unland ist hier im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzfläche verhältnismäßig hoch. In den gemäßigten Breiten überwiegt Dauergrünland mit Viehwirtschaft gewöhnlich den Ackerbau. Letzterer ist meist ein ertragsarmer Anbau von Getreide und Kartoffeln. Bedeutendster Zweig der Höhenlandwirtschaft ist die Almwirtschaft.
Die tropische Höhenlandwirtschaft erlaubt den Anbau von Kulturpflanzen subtropischer und gemäßigter Breiten sowie die Haltung von Vieh, das die klimatischen Bedingungen der tropischen Tiefländer schlecht verträgt.
(s. a. Berglandwirtschaft)
Als Höhenstufen werden in der Ökologie, Geobotanik und Biogeographie die klimatisch bedingte Vertikalgliederung gleichartiger natürlicher Vegetation in Gebirgen bezeichnet. Mit zunehmender Höhe modifiziert der atmosphärische Temperaturgradient die landschaftsökologischen Prozesse des Wasserhaushaltes, der Bodenbildung oder des ökophysiologischen Geschehens in der Vegetationsdecke derart, dass sich spezielle Lebensräume herausbilden, die Höhenstufen.
Diese führen in den unterschiedlichen Höhenlagen von der natürlichen Vegetation des flachen Umlandes ausgehend zu einer typischen, vertikalen Abfolge verschiedener Pflanzenformationen. Die Grenzen der einzelnen Höhenstufen sind sehr variabel und selbst bei benachbarten Gebirgen oftmals unterschiedlich.
Die Abfolge und Ausprägung der Pflanzendecke vom Gebirgsvorland bis zu den Gipfelregionen weist auf den ersten Blick große Ähnlichkeiten mit den globalen Vegetationszonen auf, deren Klima von der geographischen Breite vom Äquator zu den Polen abhängig ist. Diese zonalen Vegetationstypen sind auf globaler Maßstabsebene relativ einheitlich und können in der Regel mit sehr großräumigen Ökosystemtypen bzw. Biomen beschrieben werden. Die Bedingungen verschiedener Gebirge weisen hingegen aufgrund unterschiedlicher geographischer Breite, spezieller klimatischer Unterschiede und einer jeweils eigenen (isolierten) Stammesgeschichte des Arteninventars deutliche Unterschiede auf, die die Abweichungen verursachen. Während global etwa zwischen borealem Nadelwald, hemiborealem Übergangs-Mischwald und nemoralem Laubwald unterschieden wird, müssen im Gebirge die konkreten Pflanzengesellschaften – etwa kolliner Eichen-Hainbuchenwald, submontaner Buchenwald, tiefmontaner Tannen-Buchenwald und hochmontaner Fichten-Tannenwald – herangezogen werden.
Die natürliche Vegetationszusammensetzung der Höhenstufen kann von den Eingriffen des wirtschaftenden Menschen stark überprägt sein. Durch Rodungen kommt es beispielsweise zu einer Absenkung der physiologisch bedingten Waldgrenze, in deren Folge sich Wasserhaushalt und Bodenstruktur verändern, was zu einer Aktivierung von Naturgefahren führen kann.
Die für die Alpen entwickelte Terminologie zur Charakterisierung der Höhenstufen findet mittlerweile in allen Hochgebirgen der gemäßigten Zone Verwendung. Diese Gliederung beginnt mit der Ebenen- und Hügellandstufe (planare bzw. kolline Stufe). Sie umfasst die untersten Hangpartien und die Vorhügelzone und ist vegetationskundlich und von ihrer ökologischen Ausprägung gleichzusetzen mit dem Gebirgsvorland, das nördlich der Alpen bis 600 m NN, am Alpensüdfuß bis 800 m NN reicht.
Die Hügelstufe ist wichtiges Landwirtschaftsgebiet, dank der oft günstigen Strahlungsbedingungen werden auch wärmeliebende Sonderkulturen wie Obst oder Reben angebaut. Der kollinen Stufe schließt sich die montane Stufe (Bergstufe) an, welche durch die Bergwälder charakterisiert ist und sich in eine untere Stufe (submontane Stufe) mit Laubmischwäldern und eine hochmontane Stufe mit Nadelwäldern unterscheiden läßt. Sie reicht von 600 bis 1700 m NN. Vorherrschende Baumarten sind Buchen und Weißtannen, welche aber im Zuge der Forstwirtschaft oft durch Fichten ersetzt wurden. Oberhalb der Waldgrenze, welche in den Zentralalpen einen auffallenden Anstieg aufweist, folgt die subalpine Stufe, gekennzeichnet durch Krummholz- und Zwergstrauchgürtel. Sie bildet den Übergang zur Hochgebirgsregion (alpine Stufe), welche durch Matten und Rasengesellschaften charakterisiert ist. In dieser, in den Zentralalpen bis 3200 m NN reichenden Stufe ist noch Weidewirtschaft (Almwirtschaft) als spezielle landwirtschaftliche Nutzungsform möglich. Die alpine Stufe geht schließlich über die subnivale Stufe in die nivale Stufe über, in der ganzjährig Schnee- und Eisbedeckung Pflanzenwuchs verhindern.
Die tropischen Gebirge unterscheiden sich in ihrer vertikalen Gliederung deutlich von den Gebirgen der Außertropen. Vor allem die hygrischen und thermischen Ausprägungen lassen in den Tropen fünf Höhenstufen der Vegetation unterscheiden: Tropischer Regenwald, Tropischer Bergwald, Nebelwald, Paramo und Puna. Ursprünglich von den Anden abgeleitet, wird diese Terminologie heute für die meisten tropischen Gebirge benutzt. Die unterste Stufe, die "tierra caliente", bildet zusammen mit der darauf folgenden Stufe, der "tierra templada", die absolut frostfreien Warmtropen. Über den Warmtropen kommen keine wärmeliebenden und frostempflindlichen Pflanzen mehr vor. Die daran angrenzende Zone, die sog. "tierra fria", ist durch aperiodische Fröste gekennzeichnet und enthält verschiedene arktische Vegetationselemente. An die Waldgrenze schließt sich die "tierra helada" an, die Jahresmitteltemperaturen von 7-2°C aufweist, worauf schließlich oberhalb der Schneegrenze die vegetationsfreie "tierra nevada" folgt.
Nur wenige Alpinstufen sind vom Menschen unbeeinflusst (japanische Alpen, Ruwenzori). Durch gelegtes Feuer und Triftweide im Rahmen der Almwirtschaft sind meist der Gehölzbestand zurückgedrängt und die Waldgrenze zur Erweiterung von Hochweiden erniedrigt. In den europäischen Alpen sind gesteins- und damit zugleich bodenfeuchteabhängig vom Weidevieh gemiedene Sträucher dominant (Kalk: Kiefernsträucher, Kalk/Kristallin: Rhododendronsträucher, feuchtes Kristallin: Grünerlen).
Die Menschen haben landwirtschaftliche Produktionsstrategien entwickelt, um die unterschiedlichen Merkmale der Höhenzonen zu nutzen. Höhenlage, Klima und Bodenfruchtbarkeit setzen Obergrenzen für die Arten von Nutzpflanzen, die in jeder Zone angebaut werden können. Die in der südamerikanischen Andenregion lebenden Völker haben sich die unterschiedlichen Höhenlagen zunutze gemacht, um eine Vielzahl verschiedener Nutzpflanzen anzubauen. In den Gebirgsgemeinschaften wurden zwei verschiedene Arten von Anpassungsstrategien angewandt.
Mit dem verbesserten Zugang zu neuen landwirtschaftlichen Techniken nehmen die Bevölkerungen immer mehr spezialisierte Strategien an und entfernen sich von allgemeinen Strategien. Viele bäuerliche Gemeinschaften entscheiden sich jetzt für den Handel mit Gemeinschaften in anderen Höhenlagen, anstatt alle Ressourcen selbst anzubauen, weil es billiger und einfacher ist, sich innerhalb ihrer Höhenzone zu spezialisieren.
Bezeichnung für einen Weg, der sich durch jahrhundertelange Nutzung mit Fuhrwerken und Vieh sowie abfließendes Regenwasser in das umgebende Gelände eingeschnitten hat.
Hohlwege gibt es in verschiedenen Landschaften mit unterschiedlichen Bodenarten, bzw. Gesteinsarten. Verbreitet sind sie in Lösslandschaften als Lösshohlwege, daneben findet man sie auch in Gebieten mit starker Waldnutzung auf weichen Substraten, wie in Buntsandsteingebieten, z. B. im Pfälzerwald.
Besonders ortsnahe Hohlwege wurden bei Vorliegen geeigneter geologischer Rahmenbedingungen zum Anlegen von Felsenkellern als Vorratsräume genutzt.
An den Flanken der Hohlwege siedeln sich Stauden und Gehölze an, die Kleintieren als Unterschlupf und Nahrung dienen. Darum locken Hohlwege abends und nachts Fledermäuse an, die hier Jagd auf Nachtfalter und andere Insekten machen. Für landwirtschaftliche Gebiete und Wälder sind Hohlwege oft eine ökologische Bereicherung.
Durch menschliche Nutzung entstanden, droht den Hohlwegen heute durch Menschen wie auch durch Bodenerosion Verfall: Ungenutzte Hohlwege verwuchern oder rutschen zu. Heute arbeiten vielfach Bürger und Behörden zusammen, um Hohlwege als Bodendenkmäler zu erhalten. Früher wurden sie oft im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen beseitigt oder auch mit Bauschutt oder Gartenabfällen verfüllt.
Hohlwege sind von kulturhistorischer und archäologischer Bedeutung für die Frühgeschichte einer Landschaft. Viele stammen schon aus der Römerzeit. Typisch für Lösslandschaften sind deren Lösshohlwege. Besonders markante Lösshohlwege findet man im Kaiserstuhl bei Freiburg und in der Schwarzwald-Vorbergzone des Breisgaus und der Ortenau. Dort werden sie vielfach als Kinzig oder Chinzig bezeichnet.
Da Löss als Lockergestein eine besondere Standfestigkeit aufweist, sind die Lösshohlwege weniger infolge der Verdichtung des befahrenen Bodens entstanden, sondern durch die Zerstörung der inneren Struktur des Löss, bei dem die mineralischen Staubkörner (großenteils Quarz) durch Kalk "zementartig" verbunden sind. Mit der Wegnutzung etwa durch Wagenräder wird diese Struktur zerstört und die "Einzelkörner" werden bei Niederschlägen abgeschwemmt. Auf diese Weise konnten sich im Kaiserstuhl im Laufe der Jahrhunderte Hohlgassen von bis zu 20 m Tiefe eingraben.
Lösshohlwege sind ökologisch wertvolle Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere, da sie spezielle Bedingungen bieten. Vor allem die Gegensätze zwischen schattigen und sonnigen, trockenen und feuchten sowie windigen und windstillen Plätzen sind verantwortlich für das Vorhandensein der Lebensgemeinschaft Hohlweg.
Begriff für Wanderarbeiter in vorindustrieller Zeit aus den Geestgebieten Nordwestdeutschlands in die küstennahen landwirtschaftlichen Intensivgebiete, die Hoch- und Niedermoore sowie (untergeordnet) in die Hafenstädte der Niederlande. Die Hollandgänger entstammten einer landbesitzlosen (allenfalls landarmen) unterbäuerlichen Schicht, den Heuerlingen. Die saisonale Abwanderung sollte die unzulängliche agrarwirtschaftliche Basis daheim ergänzen. Unter den landwirtschaftlichen Tätigkeiten, denen die Hollandgänger in den Niederlanden nachgingen, stand das Heumachen in den Marschgebieten (seit 17. Jh. spezialisierte Milchwirtschaft) an erster Stelle.
(s. a. Schwabenkinder)
Die Bezeichnung 'Hollerkolonisation' steht für die planmäßige Urbarmachung des fruchtbaren, aber von Sturmfluten bedrohten Marschlandes der Weser und Elbe mit Hilfe holländischer Kolonisten. Die Hollerkolonisation prägte das für die Elb- und Wesermarsch typische Landschaftsbild der Marschhufendörfer mit ihren sich anschließenden, gleichmäßig parzellierten Ackerflächen.
Der Anstoß ging 1106 oder 1113 von einer Gruppe landsuchender Holländer aus, die dem Hollerland seinen Namen gaben. Aufgrund der guten Erfahrungen ergriffen die Erzbischöfe von Bremen in der Folge die Initiative.
Holz (von germanisch *holta(z), ‚Holz‘, ‚Gehölz‘; aus indogermanisch *kl̩tˀo; ursprüngliche Bedeutungen, abgeleitet von indogermanisch *kel-, ‚schlagen‘: ‚Abgeschnittenes‘, ‚Gespaltenes‘, ‚schlagbares Holz‘; lateinisch lignum) bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch das harte Gewebe der Sprossachsen (Stamm, Äste und Zweige) von Bäumen und Sträuchern. Botanisch wird Holz als das vom Kambium erzeugte sekundäre Xylem der Samenpflanzen definiert. Nach dieser Definition sind die holzigen Gewebe der Palmen und anderer höherer Pflanzen allerdings kein Holz im engeren Sinn. Kennzeichnend ist aber auch hier die Einlagerung von Lignin in die Zellwand. In einer weitergehenden Definition wird Holz daher auch als lignifiziertes (verholztes) pflanzliches Gewebe begriffen.
Kulturhistorisch gesehen zählen Gehölze wohl zu den ältesten genutzten Pflanzen. Als vielseitiger, insbesondere aber nachwachsender Rohstoff ist Holz bis heute eines der wichtigsten Pflanzenprodukte als Rohstoff für die Weiterverarbeitung und auch ein regenerativer Energieträger. Gegenstände und Bauwerke aus Holz (z. B. Bögen und Schilde, Holzkohle, Grubenholz, Bahnschwellen, Holzboote, Holzhäuser, Pfahlbauten und Forts, siehe auch Holzbau) sowie die Holzwirtschaft waren und sind ein Teil der menschlichen Zivilisation und Kulturgeschichte.
Die Abholzung von Wäldern an Küsten des Mittelmeers war einer der ersten großen Eingriffe des Menschen in ein Ökosystem. Rodungen waren der erste Schritt, um das zu großen Teilen bewaldete Europa urbar zu machen.
Holz ist einer der wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe auf dem Weg in eine biobasierte Zukunft. Je länger der Rohstoff im Kreislauf bleibt, desto besser für das Klima, denn durch die Verwendung von Rest- und Recyclingmaterialien wird die stoffliche Holznutzung erhöht und der im Holz gebundene Kohlenstoff bleibt länger gebunden. Anhand der folgenden Grafik werden die einzelnen Nutzungsstationen des Kreislaufs gezeigt.

Quelle: FNR
Weitere Informationen:
Die Holzbodenfläche umfasst in der forstlichen Buchführung alle Flächen der Holzproduktion und zeitweilig unbestockte Flächen (Blößen), ferner Wege und Schneisen unter 5 Meter Breite und unbestockte Flächen von unwesentlicher Größe. Alle Flächenangaben beziehen sich auf das Ende des Abrechnungszeitraumes.
Substrate aus Restschnittholz der Fichten- und Kiefernverarbeitung zum Einsatz im Gartenbau mit dem Ziel, Weißtorf zu ersetzen. Dazu müssen Holzhackschnitzel durch Dampf bei höheren Temperaturen und Druck aufgefasert und aufgeschlossen werden.
Auch Familienfarmgesetz oder Heimstättengesetz; ein Landverteilungsgesetz der USA aus dem Jahre 1862, das bei der Westwärtsbewegung die weitestgreifenden Konsequenzen hatte. Jedem über 21-jährigen amerikanischen Bürger und gleichzeitigem Familienoberhaupt wurde gegen eine geringe Gebühr 160 acres (65 ha) zugesprochen, sobald er dieses Areal fünf Jahre bewirtschaftet hatte.
Das Gesetz war die Grundlage dafür, dass mehr als 1 Mio. Familienfarmbetriebe in den zentralen Ebenen und Plateaus entstanden. Aber das Gesetz war für viele Bewohner aus den städtischen Slums nicht die erhoffte Grundlage für das erstrebte neue Leben. Wenige Familien dieser Herkunft hatten die nötigen Mittel, um ein Farmleben zu beginnen, auch nicht auf freiem Land. Für viele verarmte Bauern aus dem Osten oder dem Mittleren Westen boten die Landzuweisungen hingegen neue Chancen.
Für die weiter westlich gelegenen ariden und semiariden Räume erwiesen sich die 160 acres als zu klein. Nach schweren Dürreperioden wurde für diese Gebiete die Fläche einer Homestead auf 320 acres (1909) bzw. 640 acres (1916) erweitert. Größere Farmbetriebe waren schon vorher dadurch entstanden, dass die gesetzlichen Bestimmungen durch Bodenspekulation unterlaufen wurden. Schließlich führte auch die wachsende Mechanisierung der amerikanischen Landwirtschaft mit der Zeit zu einem Strukturwandel, hin zu größeren und weniger Farmen.
Parallel zum Heimstättengesetz wurde das erste Morrill Act erlassen, nach dem jeder Staat Landflächen zugeteilt erhielt, mit deren Verkaufserlösen Colleges für Landwirtschaft und Technik geschaffen werden sollten. Diese noch heute bedeutsamen land-grant schools dienten der Entwicklung und Verbreitung von wissenschaftlichen Methoden in der Landwirtschaft und der Heranbildung von Technikern.
Bewegung in der U.S.-amerikanischen Geschichte, die sich für die freie Zuteilung von Land aus öffentlichem Besitz (public domain) an bewirtschaftungswillige Siedler einsetzte. Widerstand gegen diese Bestrebungen kam lange Zeit
Die Bemühungen fanden ihren Abschluss im Homestead Act von 1862.
Von Honigbienen zur eigenen Nahrungsvorsorge erzeugtes und vom Menschen genutztes Lebensmittel aus dem Nektar von Blüten oder den zuckerhaltigen Ausscheidungsprodukten verschiedener Insekten (u.a. von Blattläusen), dem sogenannten Honigtau.
Für den menschlichen Gebrauch wird Honig
Weitere Informationen:
Die Honigbienen (Apis) sind eine Gattung aus der Familie der Echten Bienen (Apidae). Haltung, Vermehrung und Züchtung von Honigbienen sowie die Produktion von Honig und weiterer Bienenprodukte ist das Betätigungsfeld der Imker.
Für die weltweite Imkerei (Bienenhaltung) hat die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) die größte Bedeutung. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet war nur Europa, Afrika und der Nahe Osten. Da sie für die Imkerei aber große Bedeutung hat, ist sie weltweit verbreitet worden, so beispielsweise bereits im Zuge der Eroberung anderer Kontinente durch die Europäer.
In vielen asiatischen Ländern wird auch die dort ursprünglich vorkommende Östliche Honigbiene in einfachen Klotzbeuten oder Höhlungen von Mauern gehalten. Diese beiden Arten brüten im Schutz von Höhlen und konnten sich dadurch sehr weit aus den tropischen Regionen heraus in gemäßigtere Klimazonen ausbreiten, wodurch sich insbesondere bei der Westlichen Honigbiene regional verschiedene Unterarten herausgebildet haben. Eine natürliche Grenze der Besiedelung wird oft durch Gebirge oder Inseln gebildet.
Die Hinterbeine der Honigbiene sind als Pollensammelapparat ausgebildet, indem der Unterschenkel und das erste Fußglied stark verbreitert sind, der Unterschenkel zudem eine Eindellung auf der Außenseite besitzt (Körbchen) und das Fußglied auf der Innenseite Borstenreihen (Bürste), mit denen die Pollen in das Körbchen des gegenüber liegenden Hinterbeins abgestreift werden (Bildung von „Höschen“). Beim Pollen sammeln bleibt der Pollen zunächst in den Haaren des gesamten Körpers hängen. Er wird dann erst während des Flugs in das Körbchen des gegenüber liegenden Beins gebracht.
Beim Besuch der Blüten sammeln die Bienen nicht nur Nektar, sondern auch Blütenstaub (Pollen), mit dem sie ihren Nachwuchs versorgen. Bienen fliegen – im Gegensatz zu anderen bestäubenden Insekten – während ihrer Sammelflüge immer nur eine Pflanzenart an, so lange diese ihnen noch ein ausreichendes Nahrungsangebot bietet. Man nennt das Blütenstetigkeit.
Zur Bereitung des Honigs, werden der aufgenommene Nektar, Honigtau oder auch Pflanzensäfte im Honigmagen mit einem enzymhaltigen Sekret der Kopfdrüsen gemischt. Der entstandene Honig wird in Waben gespeichert und reift unter Verdunstung von Wasser und weiteren enzymatischen Reaktionen heran.
Bienenprodukte waren bereits in der Steinzeit begehrt. Die älteste bekannte Zeichnung eines Menschen der einen Bienenstock räubert ist über 9.000 Jahre alt. Diese Form der Honignutzung ist älter als der Ackerbau. In Entwicklungsländern und bei vielen Urvölkern wird Honiggewinnung, auf deutsch "zeideln", auch heute noch in dieser Form betrieben. Schon vor ca.7.000 Jahren begann die gezielte Haltung von Bienen in Zentralanatolien. Seit 1000 v. Chr. wurden in Ägypten, wo Honig als Speise der Götter galt, Bienenkörbe benutzt. Um 800 befahl Karl der Große, Imkereien auf seinen Gütern einzurichten. Im 14. Jahrhundert entstand in Bayern die erste Imkerorganisation in Form der Zunft der Zeidler. In der Lüneburger Heide mit ihren ausgedehnten Heideflächen gab es schon im 16. Jahrhundert eine berufsmäßige Imkerei. Bis zum Beginn der Neuzeit war Imker bzw. Zeidler einer der angesehensten Berufe. Auch viele Bauern hielten sich Bienen. In den meisten deutschen Ländern gab es für einige Berufsstände (z. B. Dorfschullehrer) die Auflage Bienen zu halten, denn Wachs und Honig waren unentbehrlich. Erst mit der Entwicklung der modernden Chemie und Physik und der Kolonialwirtschaft (Rohrzucker) wurden die Bienenprodukte zurückgedrängt.
Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Imkerei durch mehrere Neuerungen eine revolutionäre Veränderung. Das war zunächst die Erfindung von beweglichen Wabenrähmchen 1853. 1858 wurde die Mittelwand aus Bienenwachs eingeführt, was den Bau von Bienenwaben beschleunigte. Die 1865 vorgestellte Honigschleuder erleichterte die Gewinnung des Honigs.
Die Biene erzeugt viele hochwertige Produkte: Honig, Wachs, Propolis, Gelée royale, Bienengift. Wirtschaftlich relevanter als diese Produkte ist heute die Bestäubungsleistung der Honigbienen in der Landwirtschaft als Nebenprodukt der Imkerei. Wegen ihrer Bestäubungsleistung ist die Honigbiene nach Rind und Schwein weltweit das drittwichtigste Nutztier in der Landwirtschaft. Für die Bestäubungsleistung erhält der Imker heute in den meisten Regionen der deutschsprachigen Länder (im Gegensatz zum Beispiel zu den USA) noch keinen Gegenwert.
Durch die Bestäubung erhöhen sich sowohl der Ertrag als auch die Qualität unserer Kulturpflanzen. Etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion in der Welt hängt von der Bestäubung ab. Zwischen 800 und 900 Euro beträgt der Bestäubungswert eines Bienenvolkes. Nach Schätzungen der Universität Hohenheim beträgt der ökonomische Wert der Bestäubung weltweit 70 bis 100 Milliarden Euro und in Deutschland etwa 2,5 Milliarden Euro.
Neben den klassischen Bestäubungspflanzen wie Obstbäumen und Beeren muss zusätzlich die Bestäubung von Wildpflanzen, die wiederum Nahrung zahlreicher wildlebender Tiere sind, berücksichtigt werden. So tragen die Bienen auch zur Vielfalt der Natur bei.
Noch in den Anfängen steckt bei uns die professionelle Bestäubungsimkerei. Dabei gilt das Hauptaugenmerk nicht der Honigproduktion, sondern dem Vermieten der Bienenvölker gegen Entgelt für Bestäubungsleistungen. Obwohl von der Bestäubungsleistung jeder profitiert, wird diese Leistung noch nicht entsprechend anerkannt und nur selten bezahlt. Gerade vor dem Hintergrund rückläufiger Bienenvölker wird die Bestäubungsleistung aber immer wichtiger. Anzustreben ist, den Einsatz der Bienenvölker zur Blütenbestäubung als Dienstleistung vertraglich zu regeln.
Im Ausland hat sich dieser Zweig der Imkerei bereits als "Bestäubungsindustrie" etabliert. So wird die Bestäubungsimkerei beispielsweise in den USA – mit etwa 50 Dollar Bestäubungsprämie pro Bienenvolk – zur Erzeugung von Luzerne und in Skandinavien für Rotklee betrieben. Mit dieser indirekten Nutzung der Bienen erwirtschaften manche Imker im Ausland bereits ihr Haupteinkommen. Laut deutschem Imkerbund hängen rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge in Deutschland von der Bestäubung der Honigbienen ab. Aber nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität wie Form, Zucker- und Säuregehalt, Keimfähigkeit sowie Lagerfähigkeit der Früchte, wird durch die Bestäubung gesteigert. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung ist enorm und übersteigt den Wert der Honigproduktion um das 10- bis 15-fache.
Zu den wichtigsten insektenbestäubten Nutzpflanzen gehören Obstbäume, Raps, Sonnenblumen, Erbsen, Bohnen, Paprika, Tomaten, Gewürzkräuter, Weinrebe und Getreide. Forschungsergebnisse an der Universität Wien brachten eine Ertragssteigerung von 50 Prozent bei einer Aufstellung von Bienenstöcken in der Nähe eines Rapsfeldes.
Verschiedene Studien belegen, dass auch kleine Mengen von Neonicotinoiden – also solche, die die Tiere nicht direkt töten – den Bienen schaden: Diese systemischen Pflanzenschutzmittel können zu einer Beeinträchtigung der Gehirnprozesse der Bienen führen und damit ihre Kommunikation und Orientierungsfähigkeit einschränken. Mit dem Resultat, dass die Tiere weniger Pollen sammeln und länger für die Rückkehr zum Bienenstock benötigen.
Der zuständige EU-Ausschuss sprach sich Ende April 2018 für den Vorschlag der Europäischen Kommission aus, den Einsatz von Neonicotinoiden auf Äckern zu verbieten und auf Gewächshäuser zu beschränken.
Im Jahr 2023 wurden nach Erhebungen deutschlandweit rund eine Million Bienenvölker gehalten. Dies sind 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Trend zunehmender Völkerzahlen setzte sich somit fort.
Der Durchschnittsertrag je Volk lag im Jahr 2023 bei 33,8 Kilogramm. Damit konnte das hohe Niveau des Vorjahres (34,3 Kilogramm) fast wieder erreicht werden. Zum Vergleich: 2021 lag der Ertrag je Bienenvolk bei nur 19,9 Kilogramm und war somit 2022 um gut 70 Prozent gestiegen.
Im Jahr 2023 wurden nach vorläufigen Daten rund 64.427 Tonnen Honig eingeführt und 18.018 Tonnen ausgeführt. Der Importüberschuss sank im Vergleich zum Vorjahr um 8.085 Tonnen auf rund 46.409 Tonnen. Die wichtigsten Herkunftsländer für deutsche Honigimporte sind die Ukraine, gefolgt von Argentinien und Mexiko.
Der Nahrungsverbrauch von Honig betrug im Jahr 2023 laut vorläufigen Zahlen insgesamt 80.170 Tonnen. Dies sind rund zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Dementsprechend sank der Pro-Kopf-Verbrauch auf 949 Gramm. Der Selbstversorgungsgrad hingegen stieg im gleichen Zeitraum von 39 Prozent auf 42 Prozent.
Weitere Informationen:
Hopfen (Humulus) ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Alle Hopfen-Arten kommen auf der Nordhalbkugel vor. Die Humulus-Arten sind schnellwachsende einjährige bis ausdauernde krautige Kletterpflanzen, die – von oben betrachtet – im Uhrzeigersinn winden. Der bekannteste Vertreter der Gattung ist der Echte Hopfen, der zum Bierbrauen verwendet wird.
Der Echte Hopfen (Humulus lupulus L.), ist eine mehrmals blühende Pflanze, die bis zu fünfzig Jahre alt werden kann. Ihre mehreren Unterarten und zahlreichen Sorten kommen in Eurasien und Nordamerika vor.
Es gibt Gründe, warum Hopfen nur in bestimmten Regionen dieser Welt angebaut wird. Um gut gedeihen zu können, benötigt die anspruchsvolle Pflanze nämlich besonders gute Böden und ein ganz spezielles Klima. Der Boden sollte locker und tiefgründig sein und sich im Frühjahr schnell erwärmen. In puncto Klima verlangt der Hopfen ausreichend Sonnenschein und Niederschlag, aber nicht zu viel davon. Wichtig ist Frostfreiheit zwischen den Monaten April und September.
Angebaut wird Hopfen an bis zu sieben Meter hohen Gerüstanlagen. Da die Pflanze lockeren und tiefgründigen Böden sowie ausreichend, aber nicht zu viel Sonne und Regen braucht um gut zu wachsen, wird sie nur in bestimmten Regionen angebaut. Aus den Blüten reifen bis Ende August Dolden, die dann zur Weiterverarbeitung geerntet werden. Gesiegelt und verkauft werden kann nur Hopfen, der aus anerkannten Anbaugebieten stammt. Hallertau, Tettnang und Elbe-Saale sind dafür mit der geschützten geografischen Angabe (g. g. A.) geschützt. Das Anbaugebiet Spalt trägt die geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U.).
Die wirtschaftliche Bedeutung des Hopfens besteht in seiner Verwendung als wichtigster Zusatzstoff der Bierherstellung (Bier). Der Hopfen gibt dem Bier seinen typischen Geschmack und Geruch und trägt zur Schaumbildung und Haltbarkeit bei. Bier zählt in Deutschland zu den beliebtesten alkoholischen Getränken.
Daneben werden junge Hopfensprosse roh als Salat oder gekocht als Hopfenspargel verzehrt und aus Hopfenzapfen ein sedierend wirkender Tee gewonnen. Die beruhigende Wirkung des Hopfens wird neuerdings dem in ihm enthaltenen Wirkstoff 2-Methyl-3-buten-2-ol zugeschrieben.
In Hopfenkulturen baut man vegetativ vermehrte „weibliche“ Pflanzen an, deren bis zu 12 m lange Triebe sich an Drähten und Stangen emporranken. Vor- und Nebenblätter der Blüte, deren becherförmige Drüsenhaare u.a. Hopfenbitterstoffe (Humulon, Lupulon; Bitterstoffe), etherische Öle (Hopfenöl) und Polyphenole enthalten, wachsen nach dem Verblühen zu sog. „Dolden“ heran, die im August/September geerntet werden. Zur Bierherstellung verwendet man entweder getrocknete Hopfendolden, ihr Pulver oder einen aus ihnen hergestellten Extrakt.
In Deutschland gibt es vier größere Hopfenanbaugebiete, die insgesamt auf 20.630 ha produzieren (Stand 2023). Die wichtigsten deutschen Anbaugebiete sind die Hallertau in Bayern, das Elbe-Saale-Anbaugebiet in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, das Schussental zwischen Tettnang und Ravensburg in Baden-Württemberg und die Region um Spalt in Mittelfranken. 2023 betrug im Bundesgebiet die Gesamtabwaage 41.234 Tonnen.
Das größte Anbaugebiet Deutschlands und gleichzeitig das größte der Welt ist die Hallertau in Bayern: 841 Betriebe bauten auf 17.130 Hektar im Jahr 2023 Hopfen an. Rund 1.560 Hektar wurden von 30 Höfen in der traditionellen Anbauregion Elbe-Saale, die sich über die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen erstreckt, bewirtschaftet. Im drittgrößten deutschen Anbaugebiet Tettnang in Baden-Württemberg kultivierten 124 Betriebe rund 1.520 Hektar Hopfen.
In Deutschland insgesamt gab es 2023 etwa 1.040 Hopfenanbau-Betriebe und eine Anbaufläche von 20.630 Hektar, vor gut 20 Jahren waren es noch über 5.000!
Laut dem Verband deutscher Hopfenpflanzer werden nur etwa 20 bis 30 Prozent der deutschen Hopfenernte in Deutschland verarbeitet. Der größere Teil wird in über 100 Länder der Welt exportiert.
Der in Deutschland verbleibende Hopfen wird nahezu vollständig zum Bierbrauen verwendet. Nur rund ein Prozent spielt als Arzneipflanze eine Rolle.
Im Jahr 2021 wurden weltweit 130.803 t Rohware geerntet. Mehr als die Hälfte der Gesamtmenge wurde in Europa erzeugt. Die U.S.A. als Weltmarktführer erzielten eine Ernte von 52.858 t und bauten so ihren Marktanteil weiter aus (2021/2019: +1583 t). In Deutschland wurde 2021 eine Ernte von 47.862 t Rohhopfen eingebracht. Das Spitzenergebnis des Jahres 2019 von 48.472 wurde nicht erreicht (2021/2019: - 610 t). Der drittgrößte Produzent weltweit ist Tschechien, das mit 8.306 t in 2021 eine quantitativ und zudem qualitativ überdurchschnittlich gute Ernte vorweisen konnte. In China blieb mit 6.285 t erzeugtem Rohhopfen die Erntemenge verglichen mit 2019 stabil.

Quelle: LFL
In 2021 wurde Hopfen auf einer Fläche von 62.886 ha Hopfen angebaut. Die Flächenausdehnung des Hopfenanbaus nahm somit weltweit um 520 ha zu und erreichte einen neuen Höchststand. Ursächlich dafür sind erneut Flächenerweiterungen in den USA (+458 ha) und Ozeanien (+264 ha). In Europa war die Fläche mit 32.616 ha gegenüber 2020 um 145 ha geringer. Die Verschiebungen innerhalb Europas sind auf den EU-Austritt Großbritanniens zurückzuführen.
Weitere Informationen:
Die planmäßige Zusammenarbeit auf einer Produktionsstufe zwischen (i.d.R.) rechtlich und ökonomisch selbständigen Wirtschaftseinheiten - hier Landwirten - oder der Zusammenschluss von Betriebseinheiten, zum Beispiel bei der Mast, wird heute vielfach als horizontale Integration (auch: Koordination oder Zusammenschluss) bezeichnet.
Mögliche Vorteile eines solchen Zusammenschlusses sind die Realisierung von Größenvorteilen (economies of scale) bei der Produktion, die Bereitstellung größerer Mengen eines Produktes für den Markt (Kapazitätsausweitung), die Bereitstellung von größeren einheitlichen Partien zur Stärkung der Position im Agribusiness, die Nutzung von Kostenvorteilen beim Einkauf von Rohwaren oder die Schaffung von Verbundvorteilen (economies of scope), wie z. B. Kosteneinsparungen bei der Logistik oder der Verwaltung.
Formen horizontaler Zusammenarbeit unterhalb des Größenniveaus großer transnationaler Unternehmen stellen die Erzeugergemeinschaften sowie die Betriebsgemeinschaften dar.
Zwischenbetriebliche Zusammenarbeit
Überbetriebliche Zusammenarbeit
(s. a. vertikale Integration, Wertschöpfungskette)
Siehe horizontale Integration
Botenstoffe im Organismus (Tier oder Pflanze). Als Pflanzenschutzmittel auf Hormonbasis kann man die pflanzlichen Wachstumsregulatoren bezeichnen.
Als Masthilfsmittel sind Hormone, v.a. in Form östrogenwirksamer Substanzen, unerlaubterweise auch für die landwirtschaftliche Tierproduktion (z.B. Kälbermast) eingesetzt worden. Sie bewirken eine Steigerung des Gewichtszuwachses und eine Verringerung des Futterverbrauchs. Die Mastzeit wird um ca. 10 % verkürzt. Die Verwendung natürlicher Hormone für die Gesundheit des konsumierenden Menschen wird unterschiedlich beurteilt; gewisse synthetische Hormone können aber Krebs auslösen oder Mißbildungen bewirken.
In der EG ist der Einsatz von Hormonen als wachstumsfördernde Mittel seit 1988 verboten; seit 1989 ist auch die entsprechende Fleischeinfuhr aus Drittländern untersagt. Häufige Zuwiderhandlungen bewogen die EU-Landwirtschaftsminister 1996 die Verstöße schärfer zu sanktionieren. Die Beweislast ist umgekehrt, den Bauern droht der Verlust der Mastprämie. Das Importverbot für hormonbehandeltes Fleisch führte zu einer erfolgreichen Klage der USA bei der WTO und hat möglicherweise einen Handelskonflikt zur Folge. Die USA betrachten hormonbehandeltes Fleisch als nicht gesundheitsschädlich und das Verbraucherschutz-Argument der Europäer als vorgeschoben und letztlich protektionistisch. Hormone werden in den USA bei 70 bis 95 % der Mastrinder regelmäßig verwendet.
Die EU hat den Einsatz wachstumsfördernder Hormone und die Einfuhr von hormonbehandeltem Fleisch Anfang der 1980er-Jahre verboten. Die USA und Kanada haben dieses Verbot angefochten, da es ihrer Auffassung nach gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO verstößt. Ein WTO-Berufungsgremium kam 1998 zu dem Entschluss, dass die wissenschaftliche Risikobewertung, auf welche die EU ihr Verbot stützte, nicht spezifisch genug sei. Die USA und Kanada bekamen daraufhin von der Welthandelsorganisation die Erlaubnis, Strafzölle von 100% auf EU-Importe bis zu einem Warenwert von USD 116,8 Mio. und CAD 11,3 Mio. zu erheben. Infolge der vorläufigen Vereinbarung zwischen der EU und den USA wurden die Strafzölle in den Vereinigten Staaten ab Frühjahr 2009 nur noch bis zu einem Warenwert von USD 38 Mio. erhoben.
Weitere Informationen:
Dünger, der aus zerschrotetem Horn von Schlachtvieh gewonnen wird. Üblicherweise werden für Horndünger Hörner und Hufe von Rindern zermahlen. Horndünger ist in seiner Wirkung auf den pH-Wert des Bodens neutral, aufgrund seiner organischen Herkunft sehr stickstoffhaltig, der Stickstoffgehalt (N) überwiegt mit 12 % bis 15 %. K2O und P2O5 liegen unter 1 % Massenanteil. Der Gehalt an organischer Substanz liegt zwar bei 85 %, dennoch lässt sich durch Düngung mit Horn der Gehalt an organischer Substanz im Boden nicht oder nur unmerklich erhöhen, da die enthaltene organische Substanz leicht abbaubar ist. Die düngende Wirkung des enthaltenen Stickstoffs erfolgt abhängig von Bodentemperatur, -feuchtigkeit, -durchlüftung und der Korngröße der Späne in ein bis zwei Wochen bis zu mehreren Monaten.
Horndünger wird in verschiedenen Kornstufen angeboten, so ist Hornmehl vom Boden wegen seiner geringen Korngröße (<1 mm) am leichtesten aufzunehmen und wirkt daher am schnellsten, gröberes Horngries (Korngröße 1–5 mm) wird gerne von Hobbygärtnern verwendet. Langanhaltende Wirkung haben Hornschrot bzw. Hornspäne (>5 mm). Besonders in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft wurde Horndünger im 20. Jahrhundert propagiert. Die traditionellen Horndünger waren in Deutschland weitestgehend von synthetisch hergestellten Stickstoffdüngern (sog. Kunstdüngern) verdrängt worden. Biobauern, die keine mineralischen Stickstoffdünger einsetzen dürfen, verwenden ihn mittlerweile wieder vermehrt, weil Horn ein organischer, nachwachsender Rohstoff und durch seine langsame Wechselwirkung mit dem Boden und der Natur bodenverträglicher als herkömmlicher Kunstdünger ist.
In einer Veröffentlichung der EU-Kommission wird Horn- und Hufmaterial, weil es ausschließlich aus totem Gewebe besteht, hinsichtlich BSE als unbedenklich eingestuft. Ob Horndünger BSE-Erreger ausbreiten können, ist nicht abschließend geklärt.
Siehe Gartenbau
Auch Gartenboden; Bodentyp aus der Klasse der Anthropogenen Böden. Es sind meist siedlungsnahe Böden mit mächtigen Ah-Horizonten als Folge langjähriger Gartennutzung, d.h. regelmäßiger Düngung und intensiver Pflege. International wird der Gartenboden Hortic Anthrosol genannt.
Er ist ein von Menschenhand über Generationen aus anderen Böden geschaffener Boden, der sich durch ein besonders aktives Bodenleben mit vielen Regenwürmern und Mikroorganismen auszeichnet: Diese zersetzen und durchmischen das Bodenmaterial und die reichlich vorhandenen organischen Pflanzenrückstände. Dadurch bildet sich ein eigener humusreicher und krümeliger meist dunkelgrauer Bodenbereich. Hortisole sind in traditionellen Gartenbaugebieten, Klostergärten, Bauerngärten, sowie langjährig bewirtschafteten Haus- und Kleingärten zu finden.
Hortisol
Hortisolaufschluss in Schönau ( Berchtesgadener Land). Der etwa 50 cm mächtige, dunkle Bodenbereich (Ap- und Ex-Horizont) entstand durch intensive Bearbeitung und langjährige Zufuhr von organischer Substanz (Bauerngarten). Auch Ziegelbruchstücke wurden in den Boden eingearbeitet, bei dem es sich ehemals um eine Braunerde aus Schwemmfächermaterial handelte. Das Profil mit einem Ap/Ex/Ex-lCv-Profil wurde durch eine Baumaßnahme aufgeschlossen (Ex = Horizont mit ausgeprägter Bioturbation durch tiefreichende Boden mischende Maßnahmen). Das ursprüngliche Bodenprofil dürfte eine Ah/Bv/lCv-Horizontabfolge aufgewiesen haben.
Quelle: Alexander Stahr
Gartenböden entstehen auch in kürzester Zeit nach der Errichtung von Neubaugebieten, indem mit moderner Maschinentechnik rasch organische Substanz in Form von humusreichen Gemischen aus Erdaushub, Kompost oder aus speziellen Pflanzerden in die obersten Bereiche von natürlichen Böden, in völlig durch Baumaßnahmen bis auf das verwitterte anstehende Gestein erodierten Standorte oder über Aufschüttungen eingebracht wird. Insofern besteht zwischen Rigosol (Weinbergsboden) und Hortisol bodengenetisch gesehen eine recht enge „Verwandtschaft“.
Dem Bodenkundler oder Archäologen geben Gartenböden als Elemente der Kulturlandschaft mit ihren Scherben, Holzkohleresten, Knochen etc. Auskunft über die die Siedlungs- und Kulturgeschichte.
Weitere Informationen:
Projekt der RWE zur Beheizung von Gewächshäusern mit Hilfe von unvermeidbar anfallender Niedertemperaturabwärme (28 bis 40 °C) aus dem Kühlwasser von Wärmekraftwerken. Standort des Projekts ist die unmittelbare Nähe des Kraftwerkes Niederaußem im rheinischen Braunkohlerevier. Die niedrig temperierte Abwärme bedingt die enge räumliche Nachbarschaft zum Kraftwerk. Verwandte Projekte sind Agrotherm und Limnotherm.
Die Vermarktung der Produkte erfolgt über bestehende Großmärkte am Niederrhein und in Holland (Neuss, Köln, Düsseldorf, Straelen, Grubbenvorst und Aalsmeer).
In der Antike im Gegensatz zum Viridarium Bezeichnung für den Nutzgarten.
Wörtlich: 'Geschlossener Garten'; Bezeichnung für den mittelalterlichen, nach außen durch Mauern abgeschlossenen Nutz- oder Blumengarten im Kontext der Marienikonographie: die Jungfräulichkeit ("Verschlossenheit") Mariens wird dabei bildhaft dargestellt durch den verschlossenen Garten, der zugleich etwas Paradiesisches hat.
Das Bildmotiv des Hortus conclusus geht zurück auf eine Interpretation des Hohenliedes des Alten Testamentes. Dort heißt es: "Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born."
Im mittelalterlichen Garten der Garten der Nahrungs- und Gewürzpflanzen
(s. a. Hortus sanitatis, Pomarium, Patio)
Im mittelalterlichen Garten der Heilkräutergarten.
(s. a. Hortus holerorum, Pomarium, Patio)
Das 'Huang He-Syndrom' beschreibt Bodendegradationen, die durch die Aufgabe ehemals nachhaltiger Landnutzung auf begünstigten Böden verursacht wird. Der Begriff ist Teil einer Klassifikation von Syndromen der Bodendegradation.
Der Huang He (Gelber Fluss, Länge 5.500 km) fließt durch das Lößplateau der Provinz Shaanxi in China. Die fruchtbaren Böden dieser Provinz gehören zu den am stärksten erodierenden Flächen der Erde. Seit geschichtlicher Zeit ist dort Bodenerosion zu beobachten, aber seit sich die traditionellen Landnutzungsmethoden wandeln, hat der Bodenverlust katastrophale Ausmaße angenommen.
Die nachhaltigen traditionellen Methoden der Landwirtschaft basieren auf einem hohen Personalaufwand. Arbeitsintensive, kleinräumige Pflegemaßnahmen, wie z.B. die Erhaltung terrassierter Hänge oder Maßnahmen gegen Winderosion werden bei veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tendenziell unrentabel. Sobald die Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen vernachlässigt werden, verstärkt sich die Erosion. Ein Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch Mechanisierung der Landwirtschaft erfordert hohen Kapitaleinsatz und stößt häufig aufgrund topographischer Gegebenheiten an Grenzen.
Neben der Huang He-Region finden sich weitere durch dieses Syndrom betroffene Gebiete unter anderem auf den Philippinen (Banaue), in Indonesien und auf fruchtbaren Vulkanböden im Bereich des ostafrikanischen Grabens.
Der Wandel der Landnutzung wird durch verschiedene, teilweise auch gleichzeitig wirkende Faktoren vorangetrieben. Die finanzielle Belastung der Landnutzer durch Mehrwertsteuerabschöpfung (Kapitalabfluss aus den betroffenen Regionen durch Steuern und Pacht an ortsfremde Eigentümer) ist eine Ursache. Mit der Öffnung der Subsistenzwirtschaft zum Weltmarkt lassen sich oft typische Abläufe beobachten: Zum einen passen sich die lokalen Erzeugerpreise an die niedrigen Weltmarktpreise an, wodurch dann die Rentabilität des arbeitsaufwendigen Landmanagements nicht mehr gegeben ist. Zum anderen wird durch den Übergang zu ertragsunabhängigen Steuern und Pachtzahlungen das Produktions- und Marktrisiko auf die Landnutzer abgewälzt. Durch Akkumulation von Schulden aus ertragsschwachen Jahren kann der Landnutzer in einen "Teufelskreis" von Verschuldung und Eigentumsverlust geraten und letztlich den Einfluss über seine Produktion verlieren. Die Folge ist die Zentralisierung und Kommerzialisierung des Landeigentums. Diese Entwicklungen können schließlich dazu führen, dass multinationale Agrokonzerne zunehmend Einfluss auf das Saatgut- und Düngemittelangebot, die Maschinenausstattung sowie die Verarbeitung und das Marketing gewinnen. Damit werden die traditionellen Landnutzungsformen endgültig abgelöst. Hier ist zugleich ein Übergang zum Dust Bowl-Syndrom möglich: auf Gunstböden werden infolge dieser Entwicklung mit hohem Kapitaleinsatz cash crops für den Export produziert. Die Landbevölkerung wird auf marginale Böden abgedrängt, oft mit massiven Bodendegradationsfolgen (Sahel-Syndrom).
Wesentliche Auswirkungen des Huang He-Syndroms betreffen die Hydrosphäre, da durch Erosion abgeschwemmter Boden in Flußläufen, Staubecken und auch im Meer erhebliche Schäden verursachen kann (Verschlammung, Überschwemmung, Eutrophierung der anliegenden Küstengewässer). Der Druck richtet sich auch auf die Biosphäre, denn großflächige Veränderungen in der Landnutzung stören das ökologische Gleichgewicht und führen zur Reduzierung der Biodiversität. Beispiele für atmosphärische Auswirkungen sind die vermehrte Emission von Treibhausgasen aus intensivierter Produktion (z.B. Methan aus Reisfeldern) und der mögliche regionale Klimawandel.
Durch Kanäle und Gräben bewässertes, intensiv genutztes Gemüse- und Obstbauland in Spanien, vorzugsweise in Flussauen, Flussmündungen und Küstenhöfen gelegen. Der Begriff Huerta steht sowohl für kleinparzelliertes Land mit Gartenbewässerung wie für eine Hortikultur, die heute agroindustrielle Züge angenommen hat. Die intensive Gartenbaukultur wird häufig im Stockwerkbau mit Baumhainen und Gemüse als Unterkultur betrieben. Der Begriff leitet sich vom lat. hortus (Garten) ab.
Ursprünglich sind Huertas typisch maurische Bewässerungsanlagen.
Die bekanntesten sind die Huertas von Murcia, Valencia und Alicante sowie die Vegas von Valencia, Granada, Malaga und Motril. Um 1970 begann ein dramatischer Umstrukturierungsprozess, der nach dem EU-Beitritt Spaniens (1986) und der Öffnung des globalen Agrarmarktes noch verschärft wurde. Das ernüchternde Ergebnis ist in den Treibhauslandschaften (mar del plástico) von Almeria und Murcia zu besichtigen.
Die auch heute sehr intensiv genutzte Huerta von Valencia stützt sich für die Bewässerung immer noch auf die Kanäle aus mittelalterlicher Zeit. Das Wasser wird aber mit moderner Technik wie Sprinkleranlagen oder Tropfbewässerung verteilt.
Auch in Südfrankreich, Süditalien und in Griechenland sind vergleichbare Strukturen der Agrarlandschaft anzutreffen.
In Süddeutschland auch Hube; Bezeichnung für sowohl eine bäuerliche Besitzeinheit mit Hofstätte und dem zugehörigen Anteil an Flur und Allmende, die sich von regional verschiedenen historischen Ackermaßen ableitet, als auch für die von einem Mitglied der bäuerlichen Gemeinde bewirtschafteten Fläche.
Die Ackermaße waren Grundlage für die planmäßige Anlage von ländlichen Siedlungen (Plansiedlung) und bäuerlichen Betriebsflächen vor allem in Kolonisationsgebieten. Gleichzeitig waren die Hufen wesentlicher Teil einer Abgaben- und Rechtsordnung, indem damit der entsprechende Anteil an der Allmende und der Grad der Teilnahme der Bewohner an der Gemeindeverwaltung festgelegt war.
Als Flächenmaß ist die Hufe regional sehr unterschiedlich groß, entsprechend der örtlichen Bodenschätzung (Bonitierung), also der Ertragsleistung der Böden. Insofern ist sie auch ein Maß für die Wirtschaftsleistung eines landwirtschaftlichen Betriebes, die Hufe entsprach etwa der Grundgröße, die nötig ist, einer Bauersfamilie ein Auskommen zu gewährleisten. Damit sind die unterschiedlichen lokalen wie zeitlichen Definitionen der Hufe auch eine wichtige historisch-agrarsoziologische Kenngröße.
Die Hufen bildeten an Wegen, Flüssen, Kanälen und Deichen aufgereihte Besitzparzellen, die sich oft an die Hofstellen direkt anschlossen. Typenbeispiele sind das Waldhufendorf, Marschhufendorf, Moorhufendorf, Hagenhufendorf im Kontext der Küsten-, Binnen- und Ostkolonisation (u.a. Nordseeküste, Frankenwald, Odenwald, Nordschwarzwald, Sudeten, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Mühl- und Waldviertel). Hufenfluren finden sich auch in neuweltlichen Kolonisationsgebieten, z. B. in Quebec, Südchile, Louisiana.
Die Größe mitteleuropäischer Hufen betrug häufig zwischen 7,5 und 15 ha, die fränkische Hufe besaß 24 ha (z.B. als Maßgröße der Ackernahrung in Rodungsgebieten wie dem Erzgebirge), die flämische Hufe 16 ha (z.B. in Schlesien bei der Anlage von Waldhufensiedlungen) und die Königs- oder Holländerhufe 48 ha (z.B. in der Wesermarsch).
Streifenflur mit Einödlage des Besitzes und Hofanschluss. In einzelnen Landschaften erhielten Hufenfluren durch den Gebrauch eines bestimmten Hufenmaßes eine größenmäßige Normung: Für Hufensiedlungen in der Wesermarsch waren Königs- oder Holländerhufen von rd. 48 ha, für Waldhufenfluren der deutschen Ostsiedlung fränkische Hufen von 24,2 ha charakteristisch. Solche Normungen wurden aber mit unterschiedlicher Sorgfalt umgesetzt. Neben dieser Parzellengestaltung ergeben sich die spezifischen Merkmale verschiedener Typen von Hufenfluren aus den Lagebeziehungen zwischen Flurstreifen und Wohnplatzreihe. So kann sich die Streifenparzellierung an randlich, innen oder zentral-achsial verlaufenden Wohnplatzreihen orientieren, die ihrerseits meist natürlich vorgegebenen Linien folgen oder zu ihnen korrespondieren.
Streifenflur mit Einödlage des Besitzes und Hofanschluss. In einzelnen Landschaften erhielten Hufenfluren durch den Gebrauch eines bestimmten Hufenmaßes eine größenmäßige Normung: Für Hufensiedlungen in der Wesermarsch waren Königs- oder Holländerhufen von rd. 48 ha, für Waldhufenfluren der deutschen Ostsiedlung fränkische Hufen von 24,2 ha charakteristisch. Solche Normungen wurden aber mit unterschiedlicher Sorgfalt umgesetzt. Neben dieser Parzellengestaltung ergeben sich die spezifischen Merkmale verschiedener Typen von Hufenfluren aus den Lagebeziehungen zwischen Flurstreifen und Wohnplatzreihe. So kann sich die Streifenparzellierung an randlich, innen oder zentral-axial verlaufenden Wohnplatzreihen orientieren, die ihrerseits meist natürlich vorgegebenen Linien folgen oder zu ihnen korrespondieren.
Im Gegensatz zu Block-, Gewann- und Eschfluren entstanden Hufenfluren erst relativ spät. Moorhufenflure entstanden, als man begann, in Nordwestdeutschland die großen Moore trockenzulegen. Marschhufenfluren entstanden, als man die versumpften Flussniederlegungen trockenlegte. Hufenflure entstanden auch, als die Mittelgebirge wie Spessart, Rhön, Odenwald, Frankenwald, Schwarzwald und Bayerischer Wald landwirtschaftlich erschlossen wurden. Erste Hufenfluren entstanden im Hoch- und Spätmittelalter und sind alle gekennzeichnet durch ihre planmäßige Anlage. Gehöfte wurden entlang von Bachläufen und um eine Quellmulde gebaut, die dazugehörigen Parzellen waren davon ausgehend angelegt und endeten meist in oberer Hanglage am Wald (Waldhufendorf). Auf diese Weise entstanden Rodungsinseln mitten im Wald. Aufgrund der damaligen Subsistenzwirtschaft wurde ein großer Teil der jeweiligen Parzellen ackerbaulich genutzt, auch wenn diese Standorte dafür keine idealen Voraussetzungen boten. Immer gehörte daher auch Grünlandwirtschaft und Viehhaltung zu dieser Flurform.
Die Nutzungsintensität nahm grundsätzlich mit der Hofferne der Parzellen ab. Bei Hufen in Moor- und Marschlandschaften waren die Entwässerungsgräben landschaftsprägend. An ihnen entlang entstanden häufig im Schutz von Zäunen niedrige Sträucher. Zusätzlich wurden Kopfweiden angepflanzt. Auch extensiv genutzte Feuchtstaudenflure gehören zu den landschaftsprägenden Elementen dieser Flurform.
Für die Hufe der Mittelgebirge sind die Lesesteinhaufen typisch, die entlang der Parzellengrenzen aufgeschichtet wurden. Auf ihnen entstanden häufig Hecken, die als Abgrenzung der Weiden geschätzt wurden. Obwohl insbesondere die Mittelgebirge zu einem Zeitpunkt erschlossen wurden, zu der kaum noch einfach zu erschließendes oder zu bewirtschaftendes Land zur Verfügung stand, war auf den Hufen der Nutzungsdruck insgesamt so gering, dass häufig große Raine entlang der Parzellen entstanden.
Sonderform des Plangewanns. Bei der Aufteilung wurde die Hufe als einheitliches Maß zugrunde gelegt.
Ehemals streng geregelte Flur Mittel- und Ostdeutschlands mit Dreifelderbrachwirtschaft. Die Hufengewannflur ist eine Plangewannflur aus drei großen Langgewannen, in der die (je Hof meist mehreren) Hufen von Bauern im Gemenge lagen.
Bei der Hufenflur ein gleichlaufendes Parzellenbündel innerhalb eines Streifensystems, in dem jeder Siedler eine Parzelle besitzt.
Sonderform der Hufenflur. Dabei handelt es sich um ein in mehrere gleiche Abfolgen des Besitzgemenges (Schläge) untergliedertes Streifensystem.
Reihendorf mit quer zur Siedlungsachse verlaufenden hofanschließenden Streifeneinödparzellen, das vornehmlich in Mitteleuropa während der mittelalterlichen Kolonisationstätigkeit (9. - 15. Jh.) entstand, und das nach dem regional sehr unterschiedlich großen Flächenmaß der Hufe angelegt war. Die Hufensiedlung verbindet die Vorteile der - wenn auch lockeren - Gruppensiedlung mit geschlossenem Besitz. Leitlinie der Siedlung bilden Flüsse, Bäche, Wege, Deiche oder Kanäle.
Andere Kontinente weisen Analog- und Übertragungsformen auf.
Eher historische Bezeichnung für Besitzer von (Alt)Höfen, die eine volle Ackernahrung gewähren. Hufner besaßen zugleich bevorzugte Rechte der Allmendnutzung und gehörten zur oberen bäuerlichen Schicht. Andere Regionalbezeichnungen waren u.a. Erben und Huber. Besaßen sie als Folge von Erbteilung nur einen halben Althof, sprach man von Halbhufnern, Halberben oder Halbhubern.
Vogel aus der Gattung der Hühnervögel. Bodentier mit Scharrkrallen. Allesfresser. Stammform ist das Bankiva-Huhn, das aus Asien stammt. Über 200 Haushuhnrassen, meist gesondert für die Eier- und Fleischproduktion gezüchtet, sind in Europa verbreitet. Je nach Haltungsart legt eine Legehenne im Jahr bis zu 280 Eier. Befruchtete Hühnereier müssen 20 bis 21 Tage bebrütet werden.
(s. a. Haushuhn, Hühnerhaltung)
Das Hühnerei ist das Vogelei der Haushenne und dient biologisch der Erzeugung ihrer Nachkommenschaft. Als landwirtschaftliches Produkt wird es vom Menschen als Nahrungsmittel verwendet.
Lange Zeit gehörte die Hühnerherde zum typischen Bild eines Bauernhofes. Ein Hahn scharte zehn bis zwanzig Hühner um sich. Die Herde hatte ein Hühnerhaus mit Gelegen, Sitzstangen, eingestreuter Stallfläche und ein Freigelände zum Auslauf. Einen gewissen Anteil der Eier durften die Hennen als eigene Nachzucht ausbrüten, der Rest der Eier wurde gegessen. Ließ die Legeleistung eines Huhnes merklich nach, wurde es geschlachtet und als Suppenhuhn genutzt.
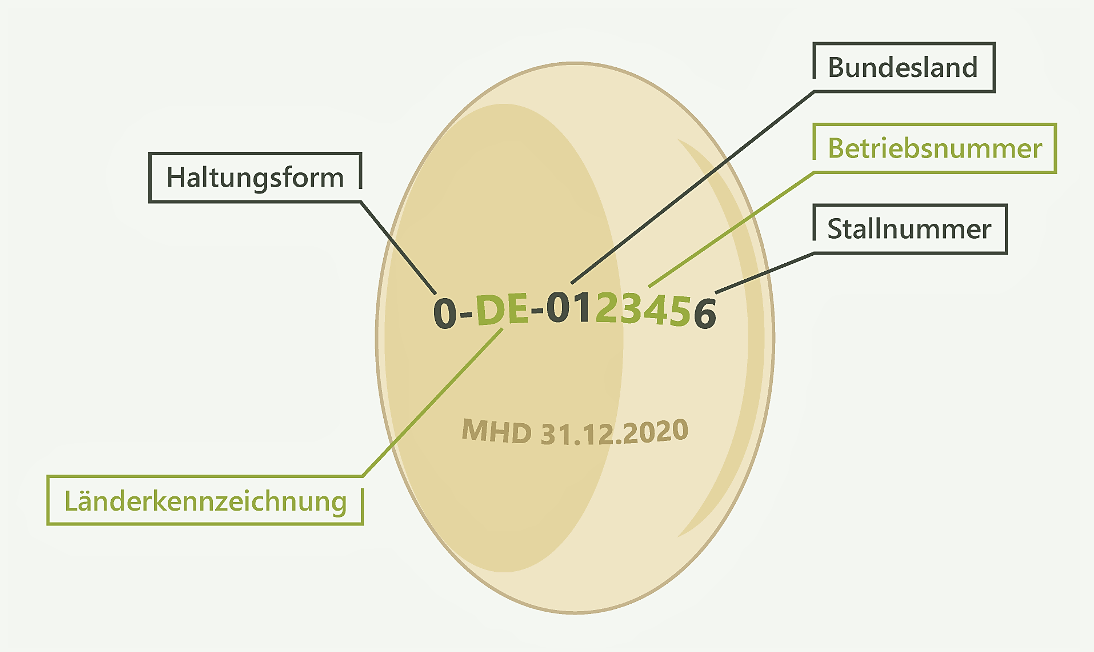
Quelle: DESTATIS 2021
Für den Verkauf werden Eier in vier Kategorien eingeteilt: Kleingruppenhaltung/Ausgestaltete Käfighaltung, Bodenhaltung und Freilandhaltung und ökologische Erzeugung. Drei dieser Kategorien werden auch in der Landwirtschaftszählung erfasst und im Folgenden näher beleuchtet. Kleingruppenhaltung – gekennzeichnet durch die „3“ auf dem Ei ist die Haltungsform, die nach dem deutschlandweiten Verbot der Käfighaltung 2009 entstand und ab Ende 2025 ebenfalls verboten ist. Eier aus Kleingruppenhaltung werden oft in der Lebensmittelindustrie verwendet. Die Bodenhaltung – die „2“ auf dem Ei – bedeutet einen offen gestalteten Stall mit erhöhten Sitzstangen, Bereichen zum Scharren und Legenestern. Freilandhaltung - die „1“ auf dem Ei - bedeutet für die Hühner einen Stall wie in der Bodenhaltung und zusätzlich eine Freilauffläche. Eine besondere Art der Freilandhaltung ist der mobile Stall. Die ökologische Legehennenhaltung mit dem Stempelaufdruck „0“ auf dem Ei, unterliegt weiteren Auflagen. Diese wird in der Landwirtschaftszählung 2020 der Freilandhaltung zugerechnet.
Die häufigste Haltungsform für Legehennen in Deutschland war 2022 die Bodenhaltung; rund 60 Prozent der Legehennen werden so gehalten. Zuletzt ist der Anteil jedoch leicht gesunken, während die Freiland- und die Ökohaltung zugenommen haben. Inzwischen wird fast jede siebte Legehenne nach Öko-Richtlinien gehalten. Die Haltung in Kleingruppen ist mittlerweile verboten, für bestehende Einrichtungen gilt eine Auslauffrist bis 2025. Aktuell werden noch fünf Prozent der Legehennen in Kleingruppen gehalten. 2015 war ihr Anteil noch mehr als doppelt so groß. In der Statistik werden Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen erfasst.
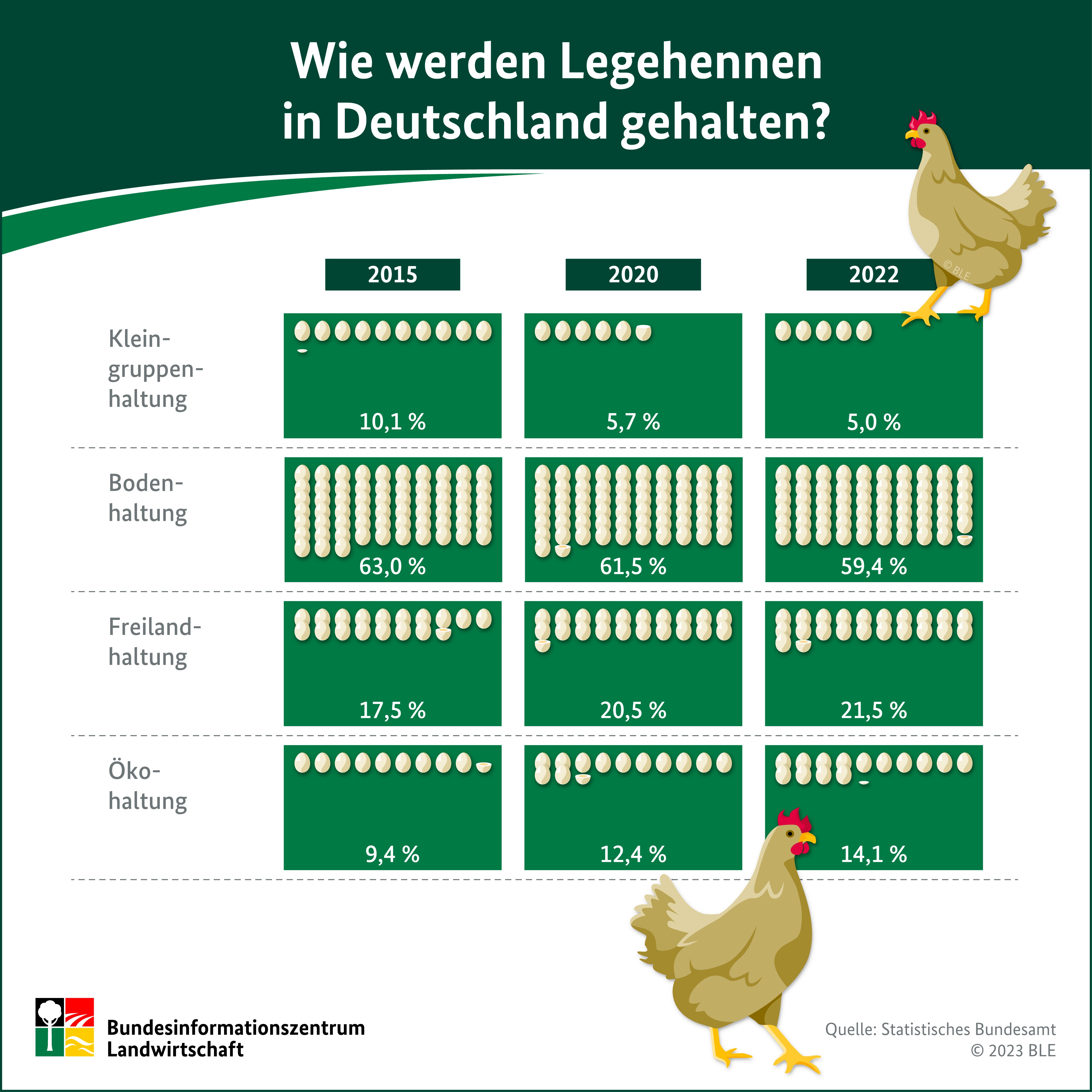
Quelle: BLE
Zur Produktion von Eiern werden in der Massentierhaltung Hybridhühner eingesetzt. Diese Rassen sind durch die Hybridzucht (Kreuzung von zwei Inzuchtlinien) auf das Legen von Eiern optimiert und haben eine Legeleistung von mehr als 300 Eiern pro Jahr. Bei der Aufzucht der Legehennen werden auch Hähne ausgebrütet – deren Aufzucht ist allerdings in der industriellen Landwirtschaft nicht wirtschaftlich. Da die männlichen Küken in der Eierproduktion keine Verwendung finden, werden diese nach dem Schlupf aus dem Ei mit CO2 vergast oder geschreddert. Weltweit passiert dies mit ca. 2,5 Milliarden Hähnen (in Deutschland sind es ca. 40 Millionen) pro Jahr. Um diese umstrittene Praxis künftig zu vermeiden, forscht man an der Universität Leipzig z. B. an der "In Ovo-Geschlechtsbestimmung" . Es handelt sich hierbei um eine spektroskopische Geschlechtsbestimmung, die sich die unterschiedliche Größe der Geschlechtschromosomen von männlichen und weiblichen Hühnern zunutze macht. Bereits nach dreitägiger Bebrütung entwickeln sich kleine Blutgefäße, die sich für eine Geschlechtsdiagnose nutzen lassen.
Der Marktführer für Legehennen in Deutschland ist die Lohmann Tierzucht GmbH. In Deutschland werden pro Jahr über 18 Milliarden Eier verbraucht. Nahezu alle der im Handel verkauften Eier stammen aus spezialisierten Legehennenbetrieben, rund 80 Prozent aus heimischen.
Die hohe Legeleistung einer Henne in Deutschland von knapp 300 Eiern wird durch bestimmte Haltungsverfahren unterstützt. In der Natur würde ein Huhn im Herbst und Winter keine Eier legen. In den Legebetrieben werden deshalb längere Tage vorgetäuscht: Das Licht brennt zunächst elf und später 15 Stunden am Tag.
Die Biologie der Legehennen lässt sich aber nicht dauerhaft überlisten. Nach etwa einem Jahr legt die Henne eine Legepause von mehreren Wochen ein. Deshalb haben Legehennen in der Regel schon nach 12 bis 15 Monaten ausgedient und werden als Suppenhühner geschlachtet.
Insgesamt gab es in Deutschland im Jahr 2020 Haltungsplätze für 60,9 Mio. Legehennen, die sich auf die verschiedenen Haltungsformen aufteilen. Durch das Verbot der Käfighaltung im Jahr 2009 ist die Zahl dieser Haltungsplätze in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Wurden 2010 noch rund 17 Prozent der Tiere in Käfigen gehalten, betrug der Anteil an ausgestalteter Käfighaltung bzw. an Haltung in Kleingruppen im Jahr 2020 lediglich 4,4 Prozent. Der Anteil der Bodenhaltung veränderte sich seit 2010 kaum und stellt mit rund 65 Prozent noch immer mehr als die Hälfte aller Haltungsplätze für Legehennen. Einen deutlichen Aufwind erlebte jedoch die Freilandhaltung. Von einem Anteil von 16,7 Prozent im Jahr 2010 stieg der Anteil auf 30,9 Prozent im Jahr 2020. Wie auch schon bei den Schweinen und Rindern ist Niedersachsen das Bundesland mit den meisten Haltungsplätzen für Legehennen (22,1 Mio.), gefolgt von Bayern (5,9 Mio.) und Nordrhein-Westfalen (5,5 Mio.).
In Deutschland gehaltene Legehennen legten 2023 durchschnittlich 295 Eier. Insgesamt legten sie 15,2 Milliarden Eier für den Konsum, von denen nach Abzug von Verlusten noch 14,2 Milliarden Eier verwendet werden konnten. Damit konnte der Inlandsbedarf zu 72,2 Prozent aus heimischer Ware gedeckt werden (-0,8 Prozentpunkte im Ver gleich zu 2023).
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern stieg 2024 auf 249 Eier und wuchs damit das zweite Jahr in Folge. Die Erzeugung von Konsumeiern im Inland erhöhte sich ebenfalls auf 15,2 Milliarden Stück (plus drei Prozent).
Dazu zählen aber nicht nur Frühstückseier. Denn Eier befinden sich unter anderem in Kuchen, Nudeln und Fertiggerichten.
Die Erzeugung von Konsumeiern im Inland sank hingegen um 119 Millionen Eier, was unter anderem zu gut sechs Prozent mehr Importen an Schaleneiern und Eiprodukten sowie zu einem niedrigeren Selbstversorgungsgrad von 73 Prozent führte.
Im Jahr 2016 wurden laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit 73,9 Millionen Tonnen Hühnerei (mit Schale) produziert. Dies entsprach etwa 1,4 Billionen Stück. Die größten Produzenten waren VR China (26.500.000 t), USA (6.037.552 t), Indien (4.561.000 t), Mexiko (2.720.194 t), Japan (2.562.243 t), Deutschland folgt auf Platz 14 (812.000 t), Österreich an 53. Stelle (113.100 t), die Schweiz an 80. Stelle (56.379 t).
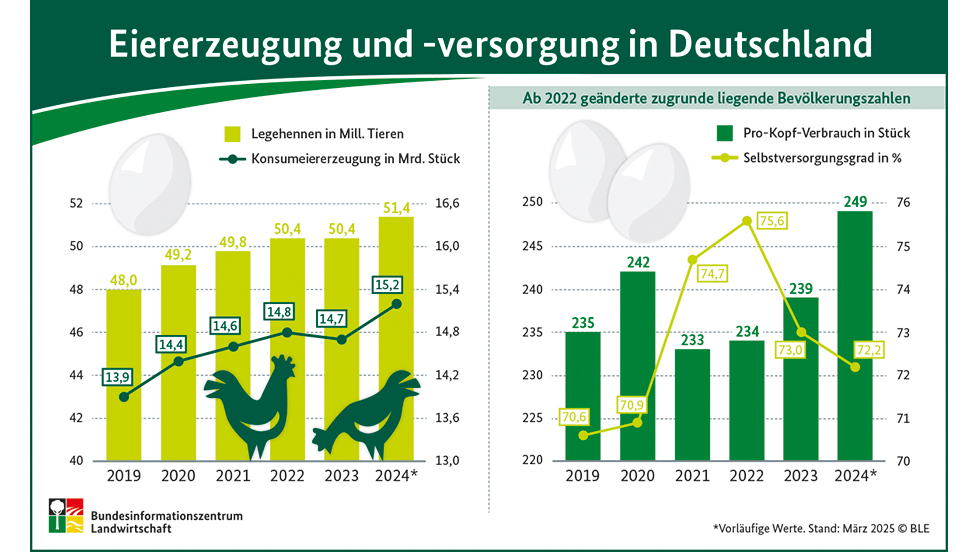
Quelle: BZL
Weitere Informationen:
Lange Zeit gehörte die Hühnerherde zum typischen Bild eines Bauernhofes. Ein Hahn scharte zehn bis zwanzig Hühner um sich. Die Herde hatte ein Hühnerhaus mit Gelegen, Sitzstangen, eingestreuter Stallfläche und ein Freigelände zum Auslauf. Einen gewissen Anteil der Eier durften die Hennen als eigene Nachzucht ausbrüten, der Rest der Eier wurde gegessen. Ließ die Legeleistung eines Huhnes merklich nach, wurde es geschlachtet und als Suppenhuhn genutzt. Die Hähne wurden gemästet zur Fleischerzeugung, daher auch der Begriff „Masthähnchen“.
Heute werden Hühner nur noch vereinzelt in landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet. Wenige international tätige Zuchtorganisationen produzieren zwei sehr unterschiedliche Spezialisten. Hochleistungs-Legehennen legen viele Eier im Jahr und Masthähnchen setzen schnell und viel Fleisch an. In der Zuchtlinie für die Mast werden sowohl Hennen als auch Hähne gemästet. In der Zuchtlinie für hohe Legeleistung werden die männlichen Küken nach dem Schlüpfen getötet, da sie als Masthähnchen zu langsam wachsen und viel weniger Fleisch ansetzen. Deshalb versucht man, schon im Ei das Geschlecht zu erkennen oder Tiere zu züchten, die sich für beides eignen: die Produktion von Eiern und von Fleisch.
Die Haltungsformen für Legehennen haben sich in Deutschland in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt und insgesamt deutlich verbessert: Einer der Hauptgründe ist, dass seit dem 1. Januar 2012 die Haltung in konventionellen Käfigen europaweit verboten ist. Legehennen werden seitdem nur noch in so genannten ausgestalteten Käfigen, in Boden- und Freilandhaltung sowie in ökologischer Erzeugung gehalten.
Die meisten deutschen Hennen leben in Bodenhaltung im geschlossenen Stall und z. T. auf mehreren Etagen. Etwa neun Tiere teilen sich einen Quadratmeter. Ohne räumliche Trennung dürfen 6.000 Tiere gemeinsam gehalten werden. Zum Scharren gibt es oft einen überdachten Auslauf – auch Wintergarten genannt.
Der Bundesrat hat am 6. November 2015 beschlossen, dass die Haltung von Legehennen in Kleingruppen in sogenannten ausgestalteten Käfigen beendet werden soll. Eine Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sieht eine Auslauffrist für bestehende Betriebe bis Ende 2025 vor. Nur für besondere Härtefälle soll eine Verlängerung der Frist um bis zu maximal drei Jahren (2028) möglich sein. Bei dieser Haltungsform sitzen 20 bis 60 Tiere in einem Käfig mit Sitzstangen, Einstreu und abgedunkeltem Nest. Der Platz, den jede Henne hat, ist etwas kleiner als eineinhalb A4-Blätter.
Nach draußen kommen nur Hennen aus Freilandhaltung und ökologischer Haltung. Sie haben tagsüber einen Auslauf von mindestens vier Quadratmetern pro Henne mit Büschen, Bäumen oder Unterständen zum Schutz vor Raubvögeln. Die ökologische Haltung zeichnet sich zusätzlich aus durch mehr Platz im Stall und Futter aus ökologischer Landwirtschaft.
Die Produktion von Eiern in der deutschen Landwirtschaft ist stark rückläufig, die Produktion wird zunehmend ins benachbarte Ausland verlagert. Bei den Verbrauchern besteht ein Widerspruch zwischen dem Anspruch, preisgünstig Hühnerfleisch/Eier zu kaufen, und der Wahrung tierschützerischer Forderungen, die mit höheren Preisen verbunden sind.
Vertikale Integration in der Erzeugung von Hühnereiern (Vollintegration)
Unter vertikaler Integration versteht man eine Organisationsform der agrarischen Produktion, in der mehrere Elemente einer Produktionskette (supply chain) unter einer einheitlichen Unternehmensführung zusammengefasst sind, die auch die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Die Erzeugung ist industriemäßig organisiert. Es wird mit Fremdarbeitskräften und einem hohen Anteil an Fremdkapital gewirtschaftet. Diese Unternehmen haben zumeist einen hohen Marktanteil. Sie können Einzelbetriebe oder Erzeugergemeinschaften vertraglich an sich binden. Sind alle Elemente einer Produktionskette wie hier unter einem Unternehmensdach vereint, spricht man von Vollintegration.
Quelle: H.-W. Windhorst, WING mod.
Herkunft der Hühnereier
Die Herkunft der Eier sowie die Haltungsform sind am Stempel zu erkennen.
Code für die Haltungsform
Ländercode (Herkunft)
Zwei Buchstaben für den EU - Mitgliedstaat, in dem das Ei produziert wurde, zum Beispiel:
Identifizierung des Betriebs
Jeder Mitgliedstaat hat ein System eingerichtet, mit dem Erzeugerbetrieben eine individuelle Nummer zugewiesen wird. Es können weitere Stellen angefügt werden, um einzelne Bestände/Ställe zu identifizieren.
Beispiel eines deutschen Erzeugercodes: 1-DE-0212341
Bei den Legehennen dominiert inzwischen die Bodenhaltung (63 Prozent). Die Tiere leben zumeist zu Zehntausenden in Volierensystemen mit mehreren Etagen. In einer Einstreu aus Stroh oder Hobelspänen können sie scharren, picken und staubbaden. In der Freilandhaltung haben die Hennen zusätzlich Auslauf ins Freie. Knapp 16 Prozent der Legehennen werden so gehalten. Bei weiteren 11 Prozent der Legehennen kommen die sogenannte Kleingruppenhaltung oder andere Formen ausgestalteter Käfige zum Einsatz. In der Kleingruppenhaltung leben die Tiere in Gruppen von bis zu etwa 65 Tieren in ausgestalteten Volierensystemen. Heute werden fast ausschließlich auf hohe Legeleistung spezialisierte Legehennen gehalten. Diese können über 300 Eier pro Jahr legen, bereits nach einem Jahr lässt die Leistung jedoch nach. Nach rund eineinhalb Jahren werden die Tiere geschlachtet und durch junge Hennen ersetzt.
Ein Masthähnchen hat ein kurzes Leben: Es wird im Brutschrank ausgebrütet und schlüpft nach 21 Tagen. Dann folgt der Transport zum Stall, wo es ca. 30 bis 40 Tage gemästet wird.
Die Belegung der Ställe ist nach Gewicht geregelt. In Deutschland dürfen die Tiere durchschnittlich nicht mehr als 39 Kilo pro Quadratmeter wiegen. Das entspricht ca. 20 bis 25 fertig gemästeten Hähnchen. Oft leben mehrere 10.000 Tiere in einem Stall. Schon nach 28 bis 30 Tagen ist ein Grillhähnchen 1.500 bis 1.600 Gramm schwer und wird geschlachtet. Hühner, deren Brust und Schenkel in den Handel kommen, werden mit etwa 40 Tagen etwas älter.
Nur ein Prozent der Hähnchen kommen aus biologischer Haltung. Sie haben einen Teil ihres Lebens Auslauf im Freien und erhalten Biofutter.
Bei Masthühnern, herrscht Bodenhaltung in großen Beständen vor. Es werden auf hohe Gewichtszunahme und gute Futterverwertung spezialisierte Tiere eingesetzt. Masthühner wiegen am ersten Tag ihres Lebens etwa 40 Gramm, fünf bis sieben Wochen später haben sie ihr Schlachtgewicht von eineinhalb bis zweieinhalb Kilo erreicht. Gemäß den tierschutzrechtlichen Vorgaben darf bei der Haltung von Masthühnern in Deutschland eine maximale Besatzdichte von 39 kg pro Quadratmeter nicht überschritten werden. In der Praxis bedeutet dies, dass sich gegen Ende der Mastzeit meist 16 bis 26 Tiere einen Quadratmeter Stallboden teilen. Die Mast von Puten nimmt mehr Zeit in Anspruch. Hennen erreichen nach etwa 16 Wochen ihr Schlachtgewicht von rund zehn Kilo, die Hähne werden meist in 22 Wochen auf etwa 20 Kilo gemästet. (BMEL)
Vertikale Integration (räumlicher Produktionsverbund) in der Erzeugung von Jungmasthühnern
Unter vertikaler Integration versteht man eine Organisationsform der agrarischen Produktion, in der mehrere Elemente einer Produktionskette (supply chain) unter einer einheitlichen Unternehmensführung zusammengefasst sind, die auch die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Die Erzeugung ist industriemäßig organisiert. Es wird mit Fremdarbeitskräften und einem hohen Anteil an Fremdkapital gewirtschaftet. Diese Unternehmen haben zumeist einen hohen Marktanteil. Sie können Einzelbetriebe oder Erzeugergemeinschaften vertraglich an sich binden.
Quelle: H.-W. Windhorst, WING
Großbetriebe mit mehr als 50.000 Tieren bestimmen die Masthühnerhaltung in Deutschland. Dort werden mehr als drei Viertel der insgesamt knapp 88,1 Millionen Masthühner gehalten.
Nicht einmal ein Prozent der Tiere lebt auf Betrieben mit weniger als 10.000 Tieren. Dabei gibt es solche vergleichsweise kleinen Betriebe nach wie vor durchaus in großer Zahl, auch wenn ihr Anteil in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist.
Gut 61 Prozent der Betriebe in Deutschland hielten 2023 weniger als 10.000 Masthühner. Zehn Jahre zuvor, 2013, lag ihr Anteil noch bei rund 78 Prozent.
Insgesamt gab es in Deutschland im Jahr 2020 Haltungsplätze für 60,9 Mio. Legehennen, die sich auf die verschiedenen Haltungsformen aufteilen. Durch das Verbot der Käfighaltung im Jahr 2009 ist die Zahl dieser Haltungsplätze in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Wurden 2010 noch rund 17 Prozent der Tiere in Käfigen gehalten, betrug der Anteil an ausgestalteter Käfighaltung bzw. an Haltung in Kleingruppen im Jahr 2020 lediglich 4,4 Prozent. Der Anteil der Bodenhaltung veränderte sich seit 2010 kaum und stellt mit rund 65 Prozent noch immer mehr als die Hälfte aller Haltungsplätze für Legehennen. Einen deutlichen Aufwind erlebte jedoch die Freilandhaltung. Von einem Anteil von 16,7 Prozent im Jahr 2010 stieg der Anteil auf 30,9 Prozent im Jahr 2020. Wie auch schon bei den Schweinen und Rindern ist Niedersachsen das Bundesland mit den meisten Haltungsplätzen für Legehennen (22,1 Mio.), gefolgt von Bayern (5,9 Mio.) und Nordrhein-Westfalen (5,5 Mio.).
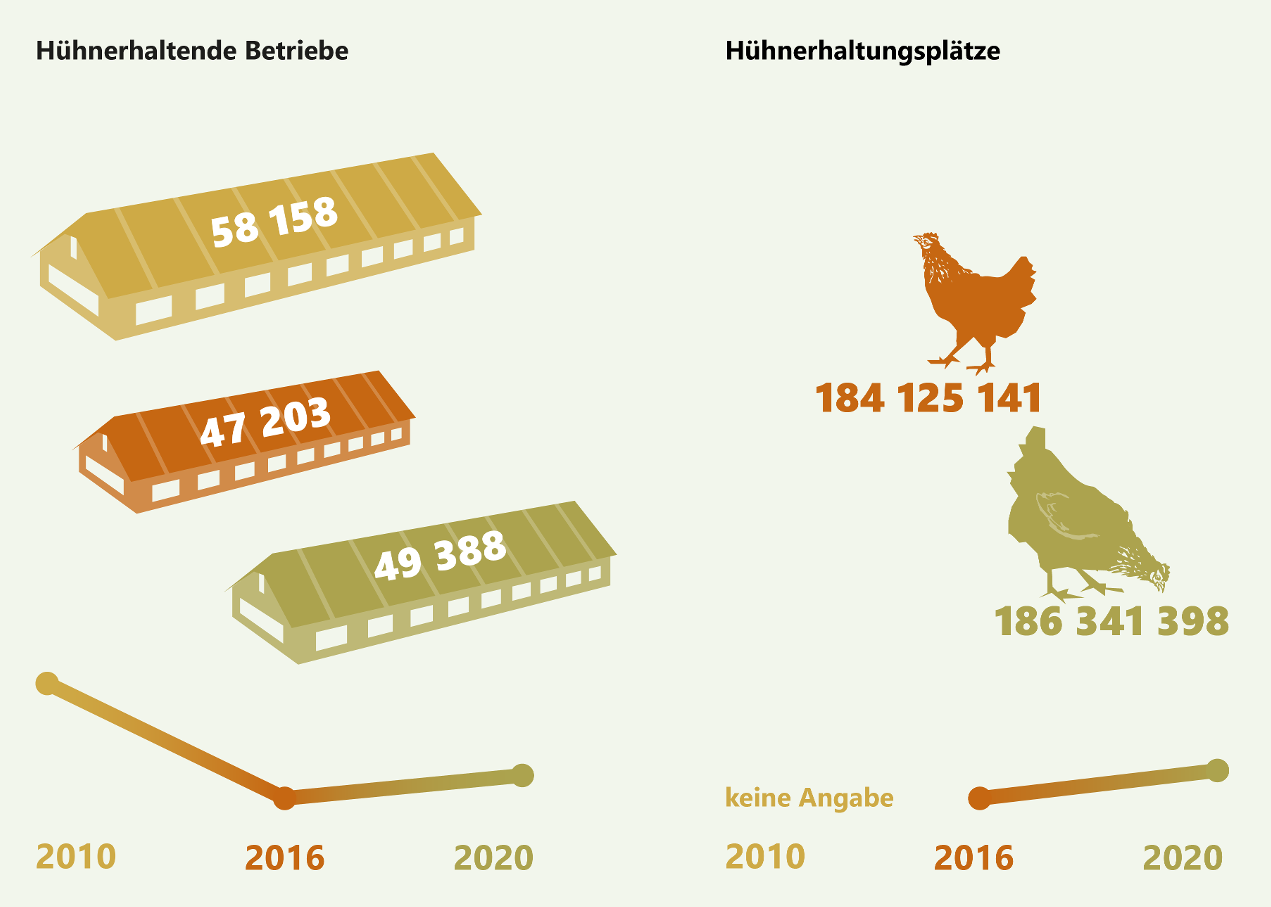
Quelle: Destatis 2021
Die mit Abstand meisten Betriebe sind Haltungen von Legehennen. Insgesamt gab es zum Stichtag 1. März 2020 rund 49 400 Betriebe mit Haltungsplätzen für Hühner, darunter gut 47 100 Betriebe mit Haltungsplätzen für die Legehennenhaltung. Die meisten Hühnerhaltungsplätze gibt es in Niedersachsen, wo sich rund 93 Mio. Hühnerhaltungsplätze und darunter knapp 22 Mio. Haltungsplätze für Legehennen befinden. Das entspricht 50 bzw. 36 Prozent der bundesweiten Kapazitäten. Danach folgen Sachsen-Anhalt mit 17,6 Mio. Haltungsplätzen für Hühner insgesamt und ca. 5,3 Mio. Haltungsplätzen für Legehennen und Bayern mit 15,9 Mio. Haltungsplätzen für Hühner insgesamt und rund 5,6 Mio. Haltungsplätzen für Legehennen. Seit 2010 ist die Anzahl der hühnerhaltenden Betriebe um 15 Prozent gesunken. Die Anzahl der Haltungsplätze wurde 2010 noch nicht erfasst. Gegenüber den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2016 zeigt sich jedoch eine leichte Zunahme der Betriebe um rund fünf Prozent bei einer nahezu konstanten Anzahl an Haltungsplätzen (plus 1,2 Prozent).
Weitere Informationen:
Auch Hülbe, eine im Bereich der Schwäbischen Alb gebräuchliche Bezeichnung für die in dieser Region typischen, nur vom Niederschlag gespeisten Teiche. Auf der Fränkischen Alb werden sie Hüll oder Hülle (Pl.: Hüllen) genannt. Sie entstanden entweder natürlich oder wurden künstlich angelegt. Die Hülen waren Grundvoraussetzung für die Besiedlung der verkarsteten wasserarmen Albhochflächen. Die Bezeichnungen stammen von mittelhochdeutsch hülwe / hulwe beziehungsweise althochdeutsch huliwa / hulwa für Pfütze, Pfuhl oder Sumpflache ab.
Die älteren Hülen auf den Hochflächen der Schwäbisch-Fränkischen Alb sind natürlichen Ursprungs. Es handelt sich um Dolinen mit einer wasserundurchlässigen Tonschicht am Grund. Der Ton ist ein Rückstand (Residuum) der Kalksteinverwitterung. Er ist in relativ geringer Menge im Kalkstein enthalten, wird aber, anders als das Kalziumkarbonat, aus dem Kalkstein hauptsächlich besteht, bei der Verwitterung nicht aufgelöst. In diesen durch den Ton „plombierten“ Dolinen kann Wasser stehen bleiben und so ein Teich entstehen.
Eine Besonderheit sind die etwas größeren Hülen im Bereich des Schwäbischen Vulkans auf der mittleren Schwäbischen Alb. Beispielsweise liegen die Hülen um Urach meist im Bereich der miozänen Vulkanschlote, die ein Versickern des Oberflächenwassers im Karst verhinderten.
Weil die Zahl solcher Wasserstellen jedoch begrenzt war, entstanden nach dem Vorbild der natürlichen Hülen im Zuge späterer Besiedlungswellen auch zahlreiche künstlich angelegte Teiche. Sie wurden mit Lehm abgedichtet und waren in der Regel etwas kleiner als ihre natürlichen Vorbilder.
Hülen sind in der Regel von Bäumen umgeben und lagen entweder als Feldhüle außerhalb oder als Dorfhüle innerhalb einer Ortschaft – meistens zentral in der Dorfmitte.
Die Feldhülen dienten in erster Linie als Viehtränke, ferner auch den Hirten als schattiger Aufenthaltsort. Die Nutzung der Dorfhülen war hingegen vielfältiger, sie wurden außer als Tränke vor allem als Löschwasserteich genutzt, oftmals befand sich das Spritzenhaus direkt daneben. Manchmal dienten sie auch zur Textilwäsche, als Flachsrotte oder als Pferdeschwemme. In Notzeiten wurde das in ihnen gesammelte Wasser aber auch als Koch- und Brauchwasser verwendet. Im Sommer waren sie für die Dorfbewohner ein beliebter Treffpunkt oder Festplatz. Im Winter wurden sie außerdem zum Eislauf benutzt. Typischerweise versammelten sich auch Gänse und Enten rund um die Hülen.
Ergänzend zu den Hülen sammelten die Bewohner das Regenwasser auch in hausnahen Zisternen, vornehmlich zur Trinkwasserversorgung. In anderen Fällen wurde das in den Dachrinnen gesammelte Regenwasser aber auch in die Hülen geleitet, dadurch konnte deren Wasservolumen zusätzlich zum eigentlichen Niederschlag erhöht werden.
Während der Dürreperioden musste das Wasser für die Hülen beziehungsweise die Zisternen oft kilometerweit mit Fuhrwerken aus anderen Ortschaften herantransportiert werden. Der Transport der Wasserfässer von den 150 bis 300 Meter tiefer im Tal gelegenen Quellen war schwierig, besonders im Winter, wenn die Aufstiegswege vereist waren.
Die hygienischen Verhältnisse des Hülenwassers waren entsprechend den Nutzungsgewohnheiten äußerst mangelhaft. Erst die ab 1870 schrittweise umgesetzte Albwasserversorgung konnte der mangelnden Wasserverfügbarkeit und -qualität mit ihrem Pumpwasser aus tiefergelegenen Tälern abhelfen.
Mit der Fertigstellung der Albwasserversorgung verloren die Hülen an Bedeutung, der überwiegende Teil verlandete im Lauf der Jahre wieder oder wurde verfüllt – insbesondere in den 1950er- und 1960er-Jahren verschwanden viele von ihnen. Die Feldhülen fielen dabei meistens der Flurbereinigung zum Opfer, die Dorfhülen wurden bebaut, in Grünanlagen umgewandelt oder mussten dem fortschreitenden Straßenausbau weichen. Auf der Schwäbischen Alb existieren deshalb heute nur noch etwa 200 Hülen, die meisten davon im Bereich der östlichen Alb. Die noch vorhandenen sind aufgrund ihrer besonderen Tier- und Pflanzenwelt in der Regel besonders geschützt, sie gelten als Naturdenkmäler (Feldhülen) bzw. Kulturdenkmäler (Dorfhülen).
Weitere Informationen:
Als Hülsenfrucht wird die charakteristische Fruchtform der Hülsenfrüchtler oder Leguminosen bezeichnet. Sie werden sowohl als Nahrungsmittel wie auch als Futtermittel verwendet. In der Küche und der in der Statistik (UN) werden nicht die Früchte selbst, sondern die darin eingeschlossenen, bei der Nutzung meist luftgetrockneten, Samen als Hülsenfrüchte bezeichnet. So zählen Frischerbsen, frische Bohnen und andere frisch geerntete Hülsenfrüchte zum Gemüse (Destatis).
In der Botanik ist die Hülsenfrucht, meist einfach als Hülse bezeichnet, eine der Fruchtformen. Sie ist definiert als eine trockene (nicht fleischige) Streufrucht, die nur aus einem Fruchtblatt besteht und sich bei der Reife sowohl an der Bauchnaht als auch an der Rückennaht öffnet.
Historisch ist beispielsweise der Anbau von Erbsen bereits ab etwa 8.000 v. Chr. belegt. Ursprung der meisten Hülsenfrüchte sind die Länder des mittleren Ostens, Mittel- und Südamerika, Afrika und in Asien vor allem China. So stammen die heutigen Kulturerbsen (Pisum sativum) vermutlich von einer Art ab, die vom östlichen Mittelmeerraum bis nach Mittelasien beheimatet ist. Die Gartenbohne (Phaseolus vulgaris) stammt dagegen aus Süd- und Mittelamerika.
Aufgrund ihres hohen Gehalts an Eiweiß, Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen und Nicht-Stärke-Polysacchariden sowie wegen möglicher großer Erträge auf kleinen Flächen sind Früchte und Samen der Hülsenfrüchte weltweit ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. Verwendet werden sowohl die vegetativen Pflanzenteile als auch die Samen. Als Weltnahrungsmittelprodukte spielen sie nach Getreide die zweitwichtigste Rolle. Allerdings werden von den ca. 1.000 Arten nur etwa mehr als 20 als Nahrungsmittel genutzt. Vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika sind Hülsenfrüchte ein sehr wichtiger Agrofood-Komplex. Dort sind sie eine ideale Ergänzung (essentielle Aminosäuren) der als Grundnahrungsmittel verwendeten Getreide- und Stärkepflanzen, was besonders wichtig bei ausschließlicher oder vorwiegender vegetarischer Ernährung ist.
Häufig in den Küchen weltweit zu finden sind u. a. Bohnen, Erbsen, Erdnüsse, Kichererbsen, Linsen, Platterbsen („Wicken“), Sojabohnen sowie Lupinen bzw. Lupineneiweiß.
Hülsenfrüchte, die vorwiegend zur Ölgewinnung verwendet werden (Sojabohnen und Erdnüsse), gelten in Statistiken als Ölfrüchte. Nicht zuletzt werden Hülsenfrüchte auch als Futtermittel (z. B. Klee und Luzerne) verwendet.
Mit dem Anbau von Leguminosen reichern die Landwirte und Gärtner den Boden mit Stickstoff an, da die Leguminosen eine für die Landwirtschaft bedeutende Eigenschaft besitzen: Ihre Wurzeln gehen mit bodenbürtigen Bakterien eine Symbiose ein. Die Bakterien sind in der Lage, Luftstickstoff zu binden und der Pflanze zuzuführen – wofür sie von der Pflanze Nährstoffe erhalten.
Hülsenfrüchte haben aufgrund ihrer Stickstoff-Fixierung vor allem als Vorkultur eine wichtige Bedeutung – nicht nur im ökologischen Anbau. Dies gilt insbesondere für nachfolgende Ackerfrüchte wie Getreide. Durch die Symbiose mit den Knöllchenbakterien im Boden können Hülsenfrüchte pro Hektar und Jahr zwischen 50 und 100 kg Stickstoff im Boden anreichern. Dieser steht dann den nachfolgenden Pflanzen zur Verfügung. (BZfE)
Hülsenfrüchte in Deutschland
Erbsen, Ackerbohnen, Süßlupinen und Sojabohnen: Auf deutschen Äckern wachsen immer mehr Körnerleguminosen. Die Anbauflächen und Erntemengen sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen, nach einem Rückgang im Jahr 2023 konnten 2024 wieder mehr Hülsenfrüchte geerntet werden.
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung wuchsen 2024 in Deutschland auf rund 258 Tausend Hektar. Das entsprach 1,55 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Während die Anbaufläche von Ackerbohnen und Süßlupinen 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht stieg und von Erbsen sogar deutlich zunahm, ist die Größe der Anbaufläche bei Sojabohnen weiter rückläufig. Insgesamt konnten die Ertragsmengen aller vier Hülsenfrüchte 2024 gesteigert werden.

Quelle: BLE
Der Anbau von Hülsenfrüchten hat in Deutschland generell nur eine geringe, aber inzwischen steigende Bedeutung. Bohnen und Frischerbsen machen zusammen weniger als 10 % der Anbaufläche von Freilandgemüse aus. Die in Deutschland angebauten Erbsen und Bohnen werden als Frischware und Verarbeitungsware angebaut. Als Frischware erfolgt der Absatz über die Direktvermarktung, Wochenmärkte und in kleinem Umfang über den Lebensmitteleinzelhandel. Als Verarbeitungsware wird das Gemüse industriell weiterverarbeitet – zum Beispiel als Tiefkühlware oder als Konserve.
Trockene Hülsenfrüchte werden praktisch ausnahmslos importiert. Hauptexportländer für Erbsen waren 2011 vor allem Kanada, Russland, die USA und Frankreich, für Bohnen China, Myanmar und die USA. Linsen kommen hauptsächlich aus Kanada, Australien, Türkei und den USA (FAO 2015).
Sojabohnen kommen vor allem aus den USA. Hierzulande ist der Anbau von Sojabohnen sehr gering, im Jahr 2013 wurden circa 2.000 t produziert (FAO 2015). Seinerzeit betrug die Anbaufläche 6.500 ha, 2014 lag sie allerdings schon bei rund 10.000 ha. Gute klimatische Bedingungen liegen nur an wenigen Standorten in Süddeutschland vor. Weltweit wurden im Jahr 2013 rund 276,4 Mio. t Sojabohnen geerntet. Davon stammten knapp 241 Mio. t – und damit gut 87 % – aus Amerika, insbesondere aus den USA, Brasilien und Argentinien. China ist mit rund 12,5 Mio. t ebenfalls ein wichtiger Produzent. In Europa gibt es eine nennenswerte Produktion in Russland und Italien (FAO 2015).
Weitere Informationen:
Prozess der Bodenentwicklung, bei dem sich sehr stabile humose Substanzen bilden, die sogenannten Huminstoffe aus der Zersetzung von Pflanzenresten. Die Hauptverantwortung für den Abbau tragen die Bodenorganismen. Bei Wasser- und Sauerstoffmangel, niedrigen Temperaturen oder anderen nicht optimalen Bedingungen für die Organismen wird ihre Abbauleistung verzögert oder nahezu vollständig unterbunden.
Huminstoffe sind dunkelgefärbte organische Kolloide der Größenordnung <2 mm mit der Fähigkeit, Wassermoleküle und Ionen reversibel zu adsorbieren.
Huminstoffe werden nach ihrem Polymerisationsgrad, nach Farbe, C- und N-Gehalt sowie Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln in die folgenden 3 Gruppen mit unterschiedlichen Eigenschaften gegliedert:
Huminstoffe entstehen durch Humifizierung und zwar entweder durch Umwandlung von Pflanzenstoffen, die bereits die zyklische Grundstruktur der Huminstoffe besitzen oder durch Neubildung aus Spaltprodukten, die bei der Verwesung anfallen und bilden den Dauerhumus. Die Huminstoffbildung wird durch Bodenlebewesen vorangebracht. Neben der Tätigkeit der Bodentiere als Voraussetzung und Beschleunigung der Huminstoffbildung greift die Mikroflora ein, deren Tätigkeit zu Stoffen führt, die durch chemische Vorgänge (Oxidation, Kondensation, Polymerisation) Huminstoffeigenschaften besitzen. Bei Bodentieren ist vor allem die Tätigkeit ihrer Darmsymbionten bei der Bildung von Huminstoffen bedeutsam.
Die Huminstoffe erhalten im Laufe der Zeit immer mehr sauerstoffhaltige Seitengruppen, wie Säure- und Phenolgruppen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele Pflanzennährstoffe und andere Moleküle und Molekülgruppen binden und wieder abspalten können. Gegenüber Pflanzennährstoffen, die im Boden als elektrisch geladene Ionen vorliegen, verhalten sich Huminstoffe wie Ionenaustauscher. Huminstoffe bilden deshalb ebenso wie Tonminerale einen wertbestimmenden Faktor für die Bodenfruchtbarkeit.
Die organische Substanz des Bodens ohne das Edaphon, gelegentlich auch die Bezeichnung für den oberen, humosen Horizont des Bodens.
Unter natürlichen Bedingungen entstammen die pflanzenwichtigen Mineralstoffe im Boden aus zwei Quellen:
Die Zufuhr von Pflanzenresten (Streu) ist bei Waldböden besonders groß. Bis zu 50 % des jährlich photosynthetisch eingebauten Kohlenstoffs gelangen in den Boden. So beträgt die jährliche Zufuhr von Pflanzenstoffen in unseren Waldgesellschaften 4,5 - 15 t/ha, in tropischen Regenwäldern 100 - 200 t/ha, auf alpinen Wiesengesellschaften 1,1 - 1,3 t/ha. Diese kaum zersetzten organischen Rückstände werden als Nährhumus bezeichnet.
Kulturflächen, denen regelmäßig Pflanzensubstanz entnommen wird, weisen einen geringen Nährhumusanteil auf, sofern die noch vorhandenen Quellen, wie Stoppeln, Stroh und Wurzeln, nicht durch organische Dünger ergänzt werden. Während der Nährhumusanteil von der augenblicklichen Zufuhr an organischem Material abhängig ist, stellt der Dauerhumus den gegen mikrobiellen Abbau widerstandsfähigen Teil dar. Die Bildung von Dauerhumusformen hängt von der Nährhumuszufuhr ab.
Die Huminstoffe des Dauerhumus bestehen aus hochpolymeren organischen Verbindungen von dunkler Farbe. Die Widerstandsfähigkeit gegen raschen mikrobiellen Abbau führt zur Anreicherung dieser Stoffe im Boden. Dieser Vorgang erklärt die dunkle Färbung der oberen Bodenschichten.
Ein nährstoffreicher, rein mineralischer Boden ist für die landwirtschaftliche Nutzung nur bedingt geeignet, da bestimmte Funktionen, die von der Zufuhr an organischem Material und der Aktivität der Bodenorganismen abhängen, nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Humus, der in Ackerböden aus den Ernterückständen (Wurzeln, Stroh, Blätter) und ggf. organischen Düngern (Gründünger, Stallmist, Gülle, Kompost) entsteht und eine wichtige Komponente der Bodenfruchtbarkeit darstellt.
Quelle: BMEL
Direkte Auswirkungen von Humusstoffen auf Pflanzen: Unbestritten ist der Einfluss von Humusstoffen auf bestimmte Enzymsysteme, auf die Plasmapermeabilität, auf Spross- und Wurzelwachstum. So werden z.B. Stickstoffraten verfügbar, die bei geringem Humusgehalt ertragsunwirksam wären. Die Adsorptionsfähigkeit des Humus gilt auch für Pestizide. Humusadsorptionskomplexe stellen somit nicht nur ständig fließende Mineralstoffquellen dar. Auch Giftstoffe gelangen über die Wurzeln in die Pflanze und von da in die weitere Nahrungskette.
Wichtige landwirtschaftliche Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Humusgehaltes von Ackerböden sind:
Weitere Informationen:
Ausdruck für die Erscheinungsform des gesamten Humuskörpers des Bodens. Sie beschreibt die unterschiedliche Kombination, morphologische Ausbildung und Tiefenverteilung der Humussubstanz in den verschiedenen Böden. Man unterscheidet die Trocken-Humusformen Mull, Moder und Rohhumus und die Feucht-Humusformen der hydromorphen Böden Feucht-Mull, -Moder, -Rohhumus, Anmoor und Torf, außerdem noch Unterwasser-Humusformen.
Mull ist die günstige Humusform nährstoffreicher, biotisch aktiver Böden mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Mineralisierung und Humifizierung sowie optimaler Einarbeitung von Humus in den Mineralboden.
Mull ist charakterisiert durch eine organische Auflage auf dem Mineralboden, die aus nicht oder nur wenig zersetzter Streu besteht (L-Horizont). Streubestandteile sind gut zu erkennnen. Bereits stark zersetztes organisches Material ist bei dieser Humusform durch Bodenorganismen schon intensiv mit dem Mineralboden vermischt. Dies verleiht dem oberen Horizont des Mineralbodens eine schwärzliche Färbung und eine deutliche Krümelstruktur, die eine gute Durchlüftung der Bodenporen ermöglicht. Die intensive Vermischung wird v.a. durch senkrecht grabende Arten von Regenwürmern bewirkt. Für das Pflanzenwachstum ist Mull wegen der vorteilhaften bodenphysikalischen Bedingungen und des relativ rasch ablaufenden Streuabbaus die günstigste Humusform.
Mull ist die Humusform der Bodentypen Schwarzerde, Rendzina, Pararendzina u.a.
Moder nimmt eine Zwischenstellung zwischen Mull und Rohhumus ein. Er ist durch das Vorhandensein dreier verschiedener Horizonte gekennzeichnet: L-, Of- und Oh-Horizont. Alle diese Horizonte befinden sich oberhalb des Mineralbodens. Senkrecht grabende Regenwürmer sind auf diesen stärker sauren Böden nicht mehr vorhanden und die Durchmischung der organischen Substanz mit dem Mineralboden ist deutlich schwächer als in Mullböden.
Moder ist die Humusform mancher Braunerden.
Rohhumus ist eine ungünstige Humusform nährstoffarmer, biotisch inaktiver Böden; schwer abbaubare, nährstoffarme Vegetationsrückstände bilden einen Auflagehumus über dem Mineralboden, mit dem es kaum eine Vermischung gibt. In dem stark sauren und häufig auch nassen Milieu dieser Böden verläuft die Zersetzung abgestorbenen organischen Materials nur sehr langsam.
Rohumus ist die Humusform des Podsols.
Der Begriff 'Hunger' beschreibt das subjektive Gefühl, das Menschen nach einer gewissen Zeit ohne Nahrung empfinden. Das Wort wird meist mit den Begriffen Nahrungsmangel oder chronisches Kaloriendefizit gleichgesetzt. Die biologische Funktion des Hungerreizes besteht darin, die ausreichende Versorgung des Organismus mit Nährstoffen und Energie sicherzustellen. Reguliert wird das Hungergefühl unter anderem durch Neurotransmitter, die im Hypothalamus produziert werden.
Bei Hunger handelt es sich um ein physisches, soziales, gesellschaftspolitisches, geschichtswissenschaftliches, psychologisches aber auch wirtschaftliches Phänomen, das je nach Betrachtungsweise unterschiedlich dargestellt werden kann.
Nach der Definition der Vereinten Nationen hungert ein Mensch, wenn er weniger zu essen hat, als er täglich benötigt, um sein eigenes Körpergewicht zu halten und leichte Arbeit verrichten zu können.
Fachleute unterscheiden drei Arten von Hunger: akuten, chronischen und verborgenen Hunger.
Akuter Hunger (Hungersnot) bezeichnet Unterernährung über einen abgrenzbaren Zeitraum. Es ist die extremste Form von Hunger und tritt häufig in Zusammenhang mit Krisen auf wie Dürren bedingt durch El Niño, Kriege und Katastrophen. Oft trifft er Menschen, die bereits unter chronischem Hunger leiden. Das gilt für knapp acht Prozent aller Hungernden weltweit.
Chronischer Hunger bezeichnet einen Zustand dauerhafter Unterernährung. Der Körper nimmt dabei weniger Nahrung auf, als er braucht. Obwohl die Medien meist über akute Hungerkrisen berichten, ist chronischer Hunger global am weitesten verbreitet. Er tritt meist in Zusammenhang mit Armut auf.
Verborgener Hunger (hidden hunger) ist eine Form des chronischen Hungers. Aufgrund einseitiger Ernährung fehlen wichtige Nährstoffe wie Eisen, Jod, Zink oder Vitamin A. Die Folgen sind auf den ersten Blick nicht unbedingt sichtbar, langfristig führt der Nährstoffmangel aber zu schweren Krankheiten. Insbesondere Kinder können sich geistig und körperlich nicht richtig entwickeln. Das Todesrisiko ist hoch. Weltweit leiden zwei Milliarden Menschen an chronischem Nährstoffmangel, auch in den Industrieländern. Verborgener Hunger schadet nicht nur den einzelnen Menschen, sondern kann die gesamte Entwicklung in den betroffenen Regionen hemmen, weil die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Menschen abnehmen.
Die Landwirtschaft erzeugt weltweit derzeit genug Lebensmittel, um zumindest rein rechnerisch alle Menschen zu ernähren. Dennoch muss jeder neunte Mensch auf der Welt jeden Abend hungrig schlafen gehen. Und das, obwohl das Recht eines jeden Menschen auf Nahrung – und zwar in ausreichender Quantität und Qualität – ein Menschenrecht ist, das im internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) völkerrechtlich verbindlich verankert ist.
Die Auflistung basiert auf Darstellungen von Welthungerhilfe, OXFAM und CARE und hat teilweise überlappende Inhalte.
Weitere Informationen:
Eine Betriebsform der Schafhaltung, seltener der Ziegenhaltung, bei der die Tiere nicht in Koppeln sondern von einem Schäfer in offenem Gelände betreut werden. Nachts sowie auch meist über Mittag sind sie gepfercht. Es wird zwischen standortgebundener Herdenhaltung (z.B. Gutsschäferei, Deichschäferei) und Wanderschäferei unterschieden. Oft wird die Hütehaltung mit einer Koppelhaltung kombiniert.
Auch Hut-, Hude- oder Hütewald; ein früher der Waldweide von Nutztieren (Schwein, Rind, Schaf, Ziege) dienender, durch den Weidegang meist lichter Bestand aus überwiegend Eichen oder/und Buchen. Die Tiere fressen dabei Eicheln, Bucheckern sowie Blätter und Zweige junger Bäume.
Durch die Waldweide wurden die jungen Gehölze des Waldes schwer geschädigt und die natürliche Verjüngung des Waldes unterdrückt. Zugleich verschafft es so aber den fruchttragenden großen Bäumen mehr Licht. Wegen der Schweinemast handelte es sich meist um Eichen- und Eichenmischwälder. Es entstanden offene, parkartige Wälder mit mächtigen breitkronigen Einzelbäumen und Baumgruppen (Mastbäume, häufig mit wulstigen Verbissformen). Hutewälder oder Hutweiden sind also menschengemachte Kulturlandschaften und keine Naturlandschaften.
Sie fanden ihre gewollte Nachahmung in den "Englischen Landschaftsparks" des 18. und 19. Jahrhunderts. Ihre größte Ausdehnung erreichten die Hutewälder im 18. Jahrhundert.
Weitere Informationen:
Das gezielte Beweiden, das "Abhüten" von Heiden, Auenlandschaften, aber auch von Wäldern mit verschiedensten Weidetieren. Dadurch entstanden bis in das 19. Jahrhundert halboffene Landschaften mit einer großen Artenvielfalt. Allerdings konnte es auch bei einem einige Wochen oder Monate dauernden Masseneinstand von Vieh zu einer starken Degradation der Landschaft kommen.
Das Wort Hute/Hutung leitet sich von derselben Wortwurzel wie (Vieh) hüten ab, es findet sich auch in Hutewald oder Hutebaum wieder. Hude ist eine niederdeutsche Form, die sich auch in norddeutschen Orts- und Flurnamen findet, nicht nur den reinen „Hude“ (wie im Fall von Hude bei Oldenburg – mit noch existierendem Hudewaldrest) oder auch Steinhude.
Auf der offenen Weide im unübersichtlichen Gelände des Waldes musste das Vieh gehütet werden – häufig von einem Hirten stellvertretend für die Viehbesitzer der Dorfgemeinschaft, der dafür mit dem Hutgeld entlohnt wurde. Die Hirten waren oft Kinder, wie es weltweit bei der Weide von Vieh ganzer Gemeinden in vielen Ländern noch heute üblich – und zumindest im Falle der Almwirtschaft im Alpenraum auch in Europa bis heute bekannt ist. Die genutzte Weide (bzw. der Wald) war entweder Gemeinbesitz oder gehörte dem (feudalen) Grundherrn und war wie auch das Ackerland gegen Abgaben zu nutzen. Die Hut (Hutung, Hute/Hude) war also auch ein Begriff des Weiderechts beziehungsweise des Mastungsrechts.
Hochofenschlacke, fein gemahlen mit einem Mindestgehalt von 42 % alkalisch wirkenden Bestandteilen (Kalk, Magnesia). Günstige Nebenwirkungen sind durch den P2O5-Gehalt und Spurenelemente wie z.B. Mangan und Silizium gegeben.
Qualitativ weniger gutes, extensiv und ungeregelt genutztes Weideland ohne Nährstoffersatz und Weidepflege, meist in ungünstigen Hanglagen gelegen. Hutungen stehen wie Triften oder teilweise auch Almen dem Ödland nahe, d.h. sie sind nicht ackerfähig oder ackerwürdig und werden wegen ihrer armen, flachgründigen Böden, ihres rauhen Klimas und dementsprechend geringen Graswuchses und wegen ihrer weiten Entfernungen von den Siedlungen als Grünland genutzt. Sie können auch in lichten Wäldern liegen (Hutewald).
Die vorwiegend in Gemeinschaftsbesitz (Gemeinde, Genossenschaft) befindliche Hutung ist nicht eingezäunt und wird als Magerweide heute nur noch unregelmäßig mit Vieh bestockt. Früher wurden die gewöhnlich Klein- und Nebenerwerbsbauern gehörenden Weidetiere i.d.R. täglich von einem (Gemeinde-)Hirten auf- und abgetrieben und auf der Fläche gehütet. Weidewirtschaftlich haben Hutungen in ihrer ursprünglichen Form im Hinblick auf die Ernährungsansprüche insbesondere der Leistungstiere nur noch geringe Bedeutung. Vielfach sind sie brach gefallen, verschiedentlich unter Naturschutz gestellt oder unter Änderung ihrer Bestände auf umbruchlosem Wege in intensivere Nutzungsformen überführt worden. Ein Minimum an Bewirtschaftungsmaßnahmen bewahrt sie vor der Verbuschung. In Deutschland findet sich diese Art nur noch bei den wenigen Wanderschäfern, die ihre Schafherden vornehmlich zur „Landschaftspflege“ einsetzen.
Die amtliche deutsche Statistik (DESTATIS) zählt Hutungen zum ertragsarmen Dauergrünland. Danach sind Hutungen oft verunkrautete, unregelmäßig beweidete Weide- und Wiesenflächen ohne Wachstumsförderung. Sie können auch in lichten Wäldern liegen (Hutewald).
Im biologischen Sinne ein Individuum, dass durch Kreuzung zweier genetisch weit entfernter Elternorganismen entstanden ist.
Es kann sich bei den Eltern um Individuen verschiedener Arten (z.B. Pferdestute und Eselhengst wird zum Maultier) oder auch um stark separiert gezüchtete Organismen einer „Inzuchtlinie“ handeln, wie es in der Pflanzenzüchtung üblich ist.
Bei Pflanzensorten, die aus immer gleichen definierten Inzuchtlinien zusammengesetzt sind, spricht man von Hybridsorten. Hybride haben den Vorteil, über die genetisch unterschiedlichen Eltern mit einem breiteren Repertoire verschiedener genetischer Informationen ausgestattet zu sein, wodurch sich die so genannte Heterosis (Bastardwüchsigkeit) erklären lässt. Dieser Heterosis-Effekt lässt Pflanzen größer und widerstandsfähiger werden und wird daher in der Landwirtschaft bei vielen Kulturpflanzen ausgenutzt. Bei Mais oder Zuckerrüben werden zum Beispiel fast ausschließlich Hybridsorten angebaut.
Allerdings ist die Hybridzüchtung sehr aufwändig. Da die meisten Pflanzen männliche und weibliche Sexualorgane besitzen, können sie sich selbst befruchten. Das aber muss bei der Hybridzüchtung verhindert werden. Daher werden die männlichen Blütenteile manuell entfernt und/oder eine künstliche Befruchtung mit den Pollen der anderen reinerbigen Elternlinie durchgeführt.
Saatgut, das durch Kreuzen genetisch verschiedener Eltern hergestellt wird. Es liefert erfahrungsgemäß eine zehn- bis zwanzigprozentige Steigerung der Ernteerträge.
Eine Kreuzung zweier nahezu homozygoter Inzuchtlinien (Populationen, die durch fortlaufende Kreuzung von Individuen der gleichen Linie (Inzucht) stark auf bestimmte Eigenschaften selektiert werden, wodurch aber oftmals ihre Fruchtbarkeit herabgesetzt wird). Die Nachkommen einer Kreuzung von zwei hochgezüchteten Pflanzensorten sind oft größer, robuster und normalerweise auch ertragreicher als ihre Eltern, ein Effekt, der als Heterosis bekannt ist.
Neben der Beeinflussung des landwirtschaftlichen Ertrages hatte die Entwicklung der Hybridzüchtung auch weitreichende sozioökonomische Auswirkungen, indem sie Saatgut zu einer Ware von kommerziellem Interesse machte. Hybridsorten können aus verschiedenen Gründen nur von speziellen Züchtern hergestellt und vermehrt werden. Einerseits ist die Entwicklung und Erhaltung von Inzuchtlinien kostspielig und erfordert eine besondere Ausbildung. Darüber hinaus zeigen Pflanzen, die aus Samen von Hybridpflanzen entstehen (2. Generation) im Durchschnitt nur 50 % der Vitalität von Hybridpflanzen der ersten Generation (sie "kreuzen aus"). Der Anbau von Hybridsorten erfordert daher die Bereitstellung des Saatgutes aus einer anderen Quelle. Dieser Umstand bildete einen Anreiz für private Unternehmen und bewirkte das Wachstum von kommerziellen Saatgutfirmen. Eine weitere Aufgabenteilung verlagert angewandte Forschung und Saatgutverkauf auf private Unternehmen, während die Grundlagenforschung hauptsächlich in Institutionen ausgeübt wird, die mit öffentlichen Mitteln arbeitet.
(s. a. Grüne Revolution, Saatgut)
Hydroponik (altgr. ὕδωρ hydōr ‚Wasser‘ und altgr. πόνος ‚Arbeit‘), auch Hydrokultur (altgr. ὕδωρ hydōr ‚Wasser‘ und lat. cultura ‚Anbau‘) ist eine Form der erdfreien Pflanzenhaltung, bei der Nutzpflanzen in einem anorganischen Substrat (Mineralwolle, Schaumstoffwürfel) oder in Kokosfasern statt in einem organische Bestandteile enthaltenden Boden wurzeln. Die Ernährung der Pflanzen erfolgt dabei über eine wässrige Lösung anorganischer Nährsalze.
Die Bezeichnung Hydroponik ist vor allem im Erwerbsgartenbau üblich.
Vorteile der Hydroponik
Weitere Informationen: